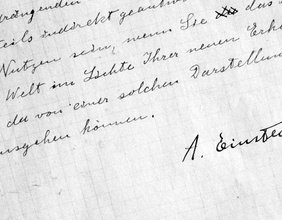Bibelkommentar zu Markus 9, 38 - 43. 45. 47 - 48
Im heutigen katholischen Gottesdienst wird eine Stelle bei Markus gelesen, die Michaela Richter gerade als Mitarbeiterin der Diakonie, des Hilfswerks der evangelischen Kirche, besonders spannend findet.
8. April 2017, 21:58
Wir haben ja, genauso wie die katholische Caritas auch, zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Konfessionen, also solche, die wie ich katholisch sind, solche, die muslimischen Glaubens sind, aber auch Agnostiker, die alle im Namen der Diakonie arbeiten.
Im Mai dieses Jahres hat der Papst ein Dekret erlassen, das die Caritas enger an den Vatikan bindet. Die Mitarbeiter der Caritas Internationalis sollen nun einen Treueeid auf den Papst und die katholische Kirche ablegen. Genau jene, die sich um sozial Schwache, Menschen in Not und Benachteiligte in der Welt kümmern, zu denen auch Menschen mit Behinderungen gehören. Im Evangelium, das in der Sendung zu hören ist, ist die Rede von einem, der im Namen Jesu Dämonen austreibt. Heute würden wir wohl eher sagen, er heilt Menschen, die psychisch krank oder intellektuell behindert sind.
Die Jünger finden das jedenfalls ganz unerhört, dass da einer im Namen Jesu tätig ist, der doch gar nicht zu ihnen gehört, ein Fremder also. Ich höre förmlich, wie sie untereinander tuscheln (auf gut Wienerisch gesagt): „Derf der denn des, kann der des, wer hat ihm denn des erlaubt?“ Hat er denn eine Berechtigung dazu, eine Legitimation? Gewerbeschein, Steuernummer, Kammermitgliedschaft, Ius practicandi, … wir Österreicher sind ja Meister, wenn es um notwendige Genehmigungen geht. Den Jüngern passt das jedenfalls gar nicht, sind sie doch die Auserwählten, die das mühsame Leben Jesu teilen, die ihm nachfolgen, wohin er auch geht, die Unbill und Schmähungen dafür auf sich nehmen. Und dann kommt da einer daher und handelt in seinem Namen, quasi mit göttlicher Vollmacht, und heilt einfach die Leute.
Verständlich, die Reaktion - wir kennen das: Gruppenzugehörigkeit, Abgrenzung und Ausgrenzung von „Anderen“. Das ist ein uralter Instinkt, denn es war evolutionär überlebens¬wichtig, auf Anhieb zu erkennen, ob der Affe, der da um die Ecke bog, zur eigenen Gruppe gehörte oder nicht, ob er schwächer oder stärker war. Entsprechend war nämlich Friede oder schleunigste Flucht angesagt.
Aber wir, die aufgeklärte zivilisierte Menschheit, kennen doch solche „niedrigen“ Instinkte nicht mehr - meint man zumindest.
In Wirklichkeit definiere ich doch ständig, d.h. ich stecke meine Grenzen ab, ich prüfe und vergleiche, ob der oder die andere vielleicht besser, erfolgreicher, jünger oder schöner ist. Ich möchte mich gegenüber anderen Menschen profilieren und versuche mich dabei durch bestimmte Verhaltensmuster, Kleidung und Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen zu legitimieren; und damit die anderen, wenn auch ungewollt, herabzuwürdigen oder auszugrenzen, besonders wenn sie neu oder fremd sind. Das beginnt schon im Kindesalter - Stichwort Mobbing.
Und die Jünger? Sie wollten diesen „Anderen“ daran hindern, in Jesu Namen tätig zu sein. Einer, der ihnen nicht nachfolgt, der darf das doch nicht. Hat Jesus doch ihnen ausdrücklich die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, erteilt. Vielleicht schwingt ja auch ein wenig Neid mit, denn ihre Heilungsversuche des besessenen Jünglings, die einige Verse davor beschrieben werden, waren erfolglos. Und die Vollmacht ist ihrer Meinung nach an die Nachfolge, nämlich die der Jünger - wohlgemerkt, nicht Jesu - geknüpft! Den Jüngern geht es hier in erster Linie darum, dass eine bestimmte Ordnung eingehalten wird, (und nicht darum, dass jemandem geholfen wird). Man muss also, anders gesagt, in der „richtigen Sukzession“ stehen, um im Namen Jesu zu handeln.
Doch Jesus stimmt nicht mit ein. „Hindert ihn nicht“, lautet seine klare Aussage dazu. “Hindert ihn nicht.“ Nicht die Gruppenzugehörigkeit ist ausschlaggebend für ihn, sondern die heilende Handlung, die Linderung der Not. „Wer nicht gegen uns ist, ist für uns“, fügt er noch hinzu. Das ist doch ein erstaunliches Zeugnis, das die Bibel hier gibt. Eines, das vor Engstirnigkeit, Kleinkariertheit und Dogmatismus bewahren will. Das zuruft: Achtung, nicht ihr allein seid die Heiligen, die Auserwählten. Nicht euer Maß ist es, das gilt, sondern meines. Nicht eure Bedingungen von Zugehörigkeit machen Jüngerschaft aus, sondern die heilende Handlung in meinem Namen, das darin sichtbare Vertrauen auf das Wirken Gottes.
Der Glaube ist das letztlich Entscheidende. Ja, ganz drastische Maßnahmen empfiehlt Jesus, die heute schwer verständlich sind, um dem eigenen Abfall vom Glauben entgegenzuwirken. Glauben heißt, auf das Wirken Gottes im eigenen Dasein zu vertrauen, in seinem Namen quasi durch Ihn und für Ihn zu leben und zu handeln.
Im Orient war der Name des Vaters, der Sippe oder des Stammes immer schon quasi Bürge für Auftrag und Autorität. Aus der Berufung auf die eigenen Vorfahren schöpfte man Zugehörigkeit und Identität. Doch Jesus durchbricht die traditionellen familiären Bande, er löst eben diese genealogischen Bindungen auf, um sie durch die Rückbindung an sich, bzw. an den Willen des Vaters zu ersetzen. Im Namen Jesu, in seinem Geist zu handeln, schafft Identität. Die Ablehnung, bzw. Herabwürdigung des Anderen entlarvt letztlich die eigene Identität als schwach, entwertet sie damit gerade und verrät sie letztlich, anstatt sie zu schützen. Ein solches Verhalten ist Ausdruck von Angst, von Unsicherheit und mangelndem Vertrauen in die Überzeugungskraft dessen, was man doch als wertvoll bewahren möchte.
Eine fest im Leben verwurzelte Identität hat es nicht nötig, sich gegen Neues oder Fremdes abzuschotten. Das Wissen darum, geliebtes und gewolltes Kind Gottes zu sein, ermöglicht ein Selbstbewusstsein, das sich nicht über äußerliche Maßstäbe definieren und abgrenzen muss. Ein überzeugter, fest gegründeter Glaube hat es auch nicht nötig, anderen, die im selben Namen, aber unter anderen Vorzeichen auftreten, ihren Glauben abzusprechen. Und eine Kirche, die sich ihrer selbst sicher ist, sollte es auch nicht nötig haben, anderen christlichen Gemeinschaften ihr Kirche-Sein abzusprechen.
Biblische Handlungsräume sind weite Räume, wo Menschen im Namen Gottes und mit göttlicher Vollmacht das Gute tun. Wo menschliche Identität und Autorität nicht durch Gruppenzugehörigkeit, und auch nicht durch Differenzierung und Ausgrenzung entstehen, sondern aus einer authentischen inneren Haltung heraus, die sich ihrer selbst und des Wirkens des göttlichen Geistes in der Welt sicher ist. Und der Geist weht, wo er will; hindert ihn nicht!