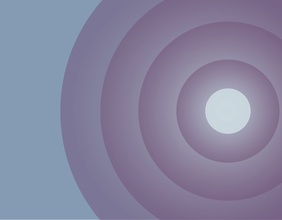"Im Journal zu Gast": EU-Parlamentspräsident Martin Schulz
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz spricht im "Journal zu Gast" über den Friedensnobelpreis für die EU, die erst beschlossene Transaktionssteuer und über das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in einigen EU-Ländern. Dramatisch sei die Lage, sagt der Präsident und fordert eine engere Zusammenarbeit in der Union.
8. April 2017, 21:58
Mittagsjournal, 13.10.2012
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz im Journal zu Gast bei Hartmut Fiedler
Friedensnobelpreis ist Würdigung und Ermahnung
Der Friedensnobelpreis sei einerseits eine Würdigung, dass das Einigungswerk Europa die längste Friedensperiode beschert hat, und andererseits eine Ermahnung, so der EU-Parlamentspräsident. Schulz spricht das Problem an, dass das Projekt "EU" von interessierten Leuten madig gemacht und mit Füßen getreten werde.
Auch ein zweites Problem sieht Schulz in diesem Zusammenhang: "Dass wir nicht effektiv genug sind auf europäischer Ebene. Das liegt daran, dass es in den letzten Jahren viele Entwicklungen gegeben hat in eine Richtung, wo der nationalstaatliche Vorrang höher bewertet wurde als die gemeinschaftlichen Interessen und das hat die EU in eine Krise geführt." Genau das abzustellen, sei aber eine Verpflichtung, um soziale Stabilität und dauerhaften Frieden zu sichern, so Schulz.
"Jugendarbeitslosigkeit: Kern unseres Problems"
In Bezug auf die steigende Jugendarbeitslosigkeit in der EU, vor allem in Ländern wie Spanien, Griechenland und Frankreich, erklärt Schulz: "Der reichste Kontinent der Erde droht in einigen Ländern seiner ganzen Generation die Zukunftshoffnungen zu nehmen." Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit werde zur Überlebensfrage für die Europäische Union, so der EU-Parlamentspräsident.
Verantwortlich für das ökonomische Ungleichgewicht in der EU macht Schulz vor allem die freie Marktwirtschaft, die seiner Meinung nach zu einem völlig fehlgeleiteten Wirtschaftssystem seit zwanzig geführt hat. Auch sozialdemokratische Regierungen haben damals an der Deregulierung der Märkte mitgewirkt, sagt Schulz: "Ich streite das überhaupt nicht ab, nur diese Erkenntnis bringt uns keinen Millimeter weiter. Weiter bringt uns zunächst einmal die Erkenntnis, dass dieses System uns in die Pleite geführt hat. Eine Pleite, die viele kleine Leute heute zahlen."
Alternative: Vermögen verteilen
Die Alternative dazu sei eine Reichtumsverteilung, so der Präsident. Eine erste Maßnahme, die er seit Jahren für notwendig gehalten habe und immer wieder gefordert habe, ist jetzt umgesetzt worden: eine Finanztransaktionssteuer. Auf den Vorwurf, die Transaktionssteuer sei eine Steuer, die die Wirtschaftstreibenden erst recht vertreibt, reagiert Schulz so: "Dieses Argument kenne ich schon lange, es beeindruckt mich nicht, weil es nicht stimmt."
Nun wird im Europaparlament für die Finanztransaktionssteuer ein Detailplan erarbeitet. Der Parlamentspräsident fürchtet jedoch, dass sich die elf Staaten im Ministerrat nicht einig werden, so wie dies oft bei solchen Regelungen der Fall sei, so Schulz. Offen ist auch noch, ob die Steuer in die EU-Kassa kommen soll oder in die Kassen der einzelnen Länder fließen sollen. Schulz: "Wenn nur elf Staaten innerhalb der 27 diese Steuern erheben, können sie sie nicht direkt in einen Haushalt der 27 einführen, denn dann nehmen auch Länder am Ertrag teil, die die Steuer gar nicht erheben. Das ist ein großes Problem."
EU-Parlamentswahlen 2014
Im Jahr 2014 wird das EU Parlament gewählt. Laut Schulz wird das einen europaweiten Wahlkampf auslösen, auch in Österreich: "Es kann sein, dass die SPÖ als Teil der Sozialdemokraten in Europa auftritt und sagt, wir unterstützen einen Finnen, weil wir glauben, dass der unsere Meinung am besten vertritt." Sprache und Nationalitäten werden keine Rolle spielen, so Schulz. Es gehe vielmehr um die Frage, ob Europa in eine sozialdemokratische oder in eine christdemokratische Richtung geführt werden soll, erklärt der Parlamentspräsident.
In Bezug auf die Souveränität der EU-Länder ist er mit Faymann einer Meinung: "Die nationalen Regierungen behalten eine besondere Rolle. Was wir erreichen müssen, ist, mit Menschen mehr darüber zu diskutieren. Dass Länder wie Österreich aber auch Deutschland, in bestimmten Bereichen an ihre Souveränitätsgrenzen gestoßen sind."