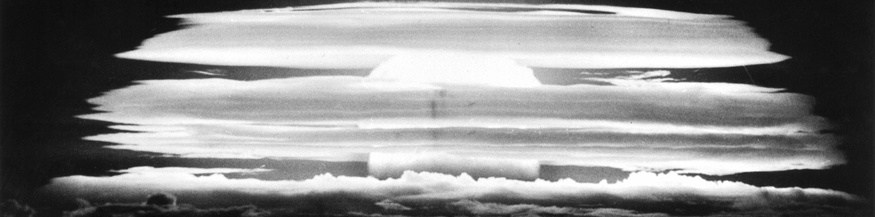Roman von Robert Schindel
Der Kalte
Manchmal sehnt man sich doch zurück nach den 1970er Jahren. Damals war es für Verlage nämlich noch billiger, die Arbeit eines Lektors zu bezahlen, der ein Buch strafft und kürzt, anstatt einen dicken Wälzer zu produzieren; heute ist es umgekehrt.
8. April 2017, 21:58
Außerdem standen prägnante, hoch strukturierte Texte damals hoch im Kurs. Heute, wo es wieder in Mode gekommen ist, auf nacherzählbare Geschichten zu setzen, als hätte es nie eine Krise des Romans gegeben, und die Produktion, wie gesagt, nicht zuletzt durch den Computersatz billiger geworden ist, erscheinen die opulenten Buchziegel ungehindert, und manchmal hat man den Eindruck eines Wettlaufes, wer den dickeren produziert.
Das scheint geradezu prestigeträchtig zu sein, und die Leser lieben es auch, in einer Geschichte behäbig Platz zu nehmen und nicht so schnell daraus entlassen zu werden. Wenn nur die Sprache nicht zu kompliziert ist und keine avantgardistischen Erzähltechniken dem Leser oder der Leserin zu viel abverlangen, dann darf's ruhig a bisserl mehr sein.
Zu viel Detailrealismus
Aber manchmal nerven die unmotivierten Längen dann doch. Zum Beispiel beim neuen Roman "Der Kalte" von Robert Schindel. Hat man etliche Hundert der über 650 Seiten gelesen, möchte man den Autor händeringend bitten, wenigstens einmal eine Person ganz einfach von einem Ort zu einem anderen gehen zu lassen. Aber nein, keine Chance bis Romanschluss: Gnadenlos werden alle Straßen, Gassen und Plätze genannt, durch die jemand nach Hause oder sonst wohin geht; und wenn er oder sie nicht zu Fuß geht, wird natürlich die Nummer der Straßenbahn angegeben.
Allerdings lässt dieser Roman noch viel mehr in quälendem Detailrealismus ersaufen. Er spielt im Wien der Jahre 1985 bis 1989 – die Waldheim-Jahre und der Aufstieg Jörg Haiders, das Mahnmal von Alfred Hrdlicka und die Auseinandersetzung um das Burgtheater in der Ära Claus Peymann werden thematisiert.
Wenn man diese Zeit in Österreich bewusst erlebt hat, bekommt man alles, woran man sich erinnert, in unzähligen Einzelheiten noch einmal serviert. Und das geschieht oft so quälend langsam, dass man beim Lesen nur mehr darauf wartet, dass das, was man weiß, dass es in nächster Zeit passieren wird, auch endlich passiert. Man weiß nur nicht, warum man das lesen muss, denn die Zeitgeschichte wird einfach abgespult, nur wenig fiktionalisiert und kaum einmal neu gedeutet.
Bekannte Tatsachen, verschlüsselte Namen
Nur die Namen sind verschlüsselt: Kurt Waldheim heißt Johann Wais, Bundeskanzler Sinowatz wird zu Theodor Marits, sein Kabinettchef Pusch firmiert unter Johannes Tschonkovits, und hinter Jupp Toplitzer verbirgt sich Jörg Haider. Claus Peymann heißt Dietger Schönn, Thomas Bernhard tritt als Raimund Muthesius auf.
Dasselbe bei den Künstlerinnen und Künstlern: Alfred Hrdlicka heißt Herbert Krieglach, Elfriede Jelinek bekommt den Namen Paula Williams verpasst, Elfriede Gerstl mutiert zu Paula Grünhut. Fritz Muliar ist Moritz Vesely, Felix Mitterer bekommt den Namen Obertschatscher. Hinter der Zeitschrift "Signal" verbirgt sich das "profil", seine Kulturredakteurin ist unverkennbar Sigrid Löffler. Leider ist keine Mutation so witzig die die der Wach- und Schließgesellschaft zur "Horch- und Guckgesellschaft". Dass man versucht ist, jede Namensverschlüsselung zu knacken, das ist vielleicht das Spannendste am Lektüreprozess.
Verschiedene Ich-Erzähler
So viel Verschlüsselung braucht allerdings eine gehörige Konzentration, und da kann man sich schon auch einmal vertun. Auf Seite 94 ist vom Naziverbrecherprozess gegen Franz Murer die Rede, aber auf Seite 274 heißt dieser Mann, der als "Schlächter von Wilna" bekannt ist, weil er im Ghetto der heutigen litauischen Hauptstadt Vilnius so viele Menschen ermorden ließ, plötzlich Gerhard Mauss. Da hat der Autor offenbar den Überblick verloren, wen er verschlüsseln wollte und wen nicht. Dafür will er ganz am Schluss noch ein Signal setzen, dass er nicht alles eins zu eins aus der Realität abgekupfert hat: Er lässt Johann Wais im Dezember 1989 zurücktreten, und auch sein Todesjahr stimmt nicht mit dem von Kurt Waldheim überein.
Erzählt wird das Ganze von verschiedenen Ichs her, aber dazwischen hat immer wieder ein Er-Erzähler den Blick auf die Totale. Da dieser Erzähler die Figuren völlig unmotiviert einmal beim Familiennamen, einmal beim Vornamen und gelegentlich auch bei dessen abgekürzter Form nennt, ist der Überblick nicht immer ganz leicht. Die Ich-Erzähler unterscheiden sich nur teilweise durch ihre Sprache voneinander, dafür ist der Er-Erzähler alles andere als sprachlich konsistent: er wechselt ohne erkennbares Motiv zwischen Hochsprache und urwienerischen Ausdrücken.
Darum braucht der Roman am Ende auch ein Glossar. In dieses hat man aber nicht nur Austriazismen oder wienerisches Vokabular verpackt, sondern alle möglichen Erklärungen. Und so kommt alphabetisch wie Wiener Melange neben dem berüchtigten Auschwitz-Arzt Dr. Mengele oder die jüdische Haggada neben dem Häferlkaffee zu stehen. Dafür fehlen in Deutschland unverständliche Ausdrücke wie "es taugt ihm"; außerdem gibt es peinliche Fehler, etwa wenn statt Buridans Esel ein Esel Buridan erklärt wird.
Starke Gespräche
Ist also alles schiefgegangen an Robert Schindels neuem Roman? Nein! Da gibt es die Titelfigur - der "Kalte" ist der Spanienveteran und KZ-Überlebende Edmund Fraul, dessen Gefühle sich nur in ständig wiederkehrenden Träumen zu äußern scheinen. Für seinen Sohn, den Burgtheater-Jungstar Karl Fraul, ist er das "antifaschistische Heldenarschloch".
Die stärksten Passagen des Romans sind jene, wo Edmund Fraul sich immer wieder mit Wilhelm Rosinger, dem ehemaligen KZ-Aufseher, trifft - zuerst zum Schachspielen, bis Fraul ihm einen Vorschlag macht: "Statt Holzfiguren hin und herzuschieben, erzählen Sie mir von Auschwitz. Vom Hin- und Hergeschiebe dort. Von Ihren Freunden, Vorgesetzten. Erzählen Sie mir von Ihrem Leben. Dort." In den Auschwitz-Erzählungen des Täters und des Opfers erreicht der Roman an wenigen Stellen eine Dichte und Einzigartigkeit, die zeigt, wozu Robert Schindel als Autor fähig und was in seinem Stoff drinnen gewesen wäre.
Service
Robert Schindel, "Der Kalte", Suhrkamp Verlag
Suhrkamp - Der Kalte