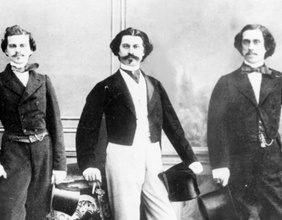Die Wiederkehr des Commons
In den 1990er Jahren erlebte die Idee des Commons eine unvermutete Wiederkehr. Der Erfolg von Linux und die Methode der Zusammenarbeit der Open-Source-Software-Entwickler rückten die Idee des Commons in den Blickpunkt.
27. April 2017, 15:40
Ursprünglich hatte es sich bei den Commons - deutsch "Allmende" - um gemeinschaftlich genutzte natürliche Ressourcen gehandelt, also wie etwa eine Alm, eine Quelle, Fischgründe. Über den Umweg des digitalen Commons+ wurde der Begriff wieder entdeckt. Und nun schließt sich der Kreis. Denn während vor 15 Jahren nur die digitale Avantgarde bei Konferenzen wie "Wizards of Open Source" vom Commons redete, haben mittlerweile auch ökologische und kapitalismuskritisch NGOs Gefallen an der Idee gefunden.

(c) CHAN NAING, EPA
Das Commons wird plötzlich mit Dingen wie Guerilla-Gärtnern und Solidar-Ökonomien in Verbindung gebracht. Und dabei eröffnet sich eine interessante Analogie: als die ursprünglichen Commons im 17. Jahrhundert in England von der Einfriedung bedroht waren, nannten sich jene, welche die Privatisierung bekämpften, "Levellers" (http://en.wikipedia.org/wiki/Levellers), was sich als Gleichmacher übersetzen lässt. Sie rissen die Zäune nieder, mit denen die Großgrundbesitzer das gemeinschaftlich genutzte Land privatisierten.
Während der Zeit des englischen Bürgerkriegs entstanden die True Levellers, eine politische Bewegung, die Gleichheit auch im politischen Sinn forderte und sich dabei auf das Lukas-Evangelium berief. Von ihren Zeitgenossen wurden sie "Diggers" genannt, weil sie den Boden aufgruben (http://en.wikipedia.org/wiki/Diggers). Sie nahmen sich die Freiheit, Zäune nieder zu reißen, Gräben aufzufüllen und in Gemeinschaftsgärten Gemüse anzubauen. Das wurde als Bedrohung der herrschenden Ordnung aufgefasst und sie wurden gewaltsam bekämpft. Obwohl es schnell gelang, die Communities der Diggers aufzulösen und zu vertreiben, erhielt sich die Erinnerung an sie in der Bevölkerung. Mit Recht werden die Diggers als direkte Vorfahren der englischen Arbeiterbewegungen des 19. Jahrhunderts gesehen.
Der US-amerikanische Historiker Peter Linebaugh hat in seinem 2009 erschienenen Buch The Magna Charta Manifesto++ gezeigt, dass die Rechte der Commoners schon in der Magna Charta verankert waren. In diesem Ursprungsdokument der englischen Demokratie war neben der Unverletzlichkeit des Körpers gegen willkürliche Übergriffe auch das Recht auf Subsistenz durch Zugang zu Gemeingütern zugesichert.
Linebaugh spricht übrigens nicht vom Commons sondern vom "commoning". Er bevorzugt es, diesen Begriff als Verb zu verwenden. Denn, so argumentiert Linebaugh, wir sind es allzu sehr gewohnt, alles als Dinge zu betrachten. Das Commons ist aber das Produkt menschlicher Arbeit. Diese Ressource existiert nicht einfach wie ein Objekt, sondern verschwindet, wenn keine Arbeit aufgewendet wird - so wie etwa Almen verwalden, wenn sie nicht bestellt werden. Laut Linebaugh hat es historisch kaum eine Gesellschaft gegeben, in deren Zentrum nicht 'commoning' gestanden hätte.
Doch wie lässt sich 'commoning' in die heutige Zeit übertragen, von der Freien Software einmal abgesehen? In Berlin gibt es das erfolgreiche Experiment des Prinzessinnengartens (http://prinzessinnengarten.net/). Ein Stück industriell kontaminiertes Land wurde durch innovative Methoden von der lokalen Gemeinschaft zum Gemeinschaftsgarten umfunktioniert. Anders als bei vielen Schrebergärten ist das Land nicht in einzelne Parzellen aufgeteilt, sondern wird gemeinschaftlich bewirtschaftet. Ein im Sommer gut besuchtes Restaurant und ein schattiger Biergarten sorgen dafür, dass die biologisch organischen Köstlichkeiten auch gleich verzehrt werden. Damit lassen sich Einnahmen generieren und sogar Arbeitsplätze schaffen.
Wie sorgt man aber dafür, dass solche Experimente keine Oase in der Wüste bleiben, eine Oase, die noch dazu, wie im Fall des Prinzessinnengartens, von Bebauungsplänen bedroht ist? Stadtentwicklung wird wohl allzu oft noch mit Betonklötze hinstellen gleichgesetzt. Welche Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden, damit Commons-basierte Projekte eine Chance im Wettbewerb haben?
Die Einzäunung der Commons stand am Beginn der Entwicklung des Industriekapitalismus. Solchermaßen ihrer Lebensgrundlage entzogen, mussten die verarmten Landarbeiter in die Stadt ziehen und bildeten die demographische Basis der Proletarisierung. Nun, im Informationszeitalter, treibt es frustrierte Kreativwirtschafter reihenweise weg von den Bildschirmarbeitsplätzen in die Gemeinschaftsgärten+++. Könnte mit dieser ökologischen Revolution auch eine ökonomische einhergehen? Eine ganz stille, leise und gewaltlose? Die nicht in einer neuen Zwangsordnung gipfelt, sondern auf echter Gleichberechtigung beruht?
Service
+ Klappe, Licht, Auftritt: The Commons
++ Linebaugh, Peter. 2009, "The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All", 1st ed. University of California Press.
+++ You Tube - Prinzessinnengarten