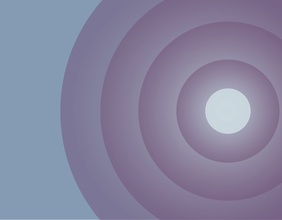Bibelkommentar zu Lukas 15, 1 - 32
In diesem Evangelientext werden gleich drei Gleichnisse erzählt. Die beiden ersten, der Gute Hirt, der das eine Schaf sucht und dafür 99 andere zurücklässt, und die Frau, die ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt, um eine Drachme wieder zu finden.
8. April 2017, 21:58
Sie zeigen nicht nur, mit welchem Einsatz und auch Risiko das Verlorene gesucht wird, sie sprechen vor allem von der Freude, wenn man es wieder gefunden hat: Freude im Himmel und Freude bei den Engeln, das zeigt: Hier geht es um etwas noch Größeres als um einen materiellen Wert.
Was Jesus jedoch im dritten Gleichnis erzählt, übersteigt das Vorhergegangene. Nicht nur ist es ein Mensch, der wiedergefunden wird, auch die Freude manifestiert sich auf eine besondere Art und Weise.
Es gibt zwei Hauptprotagonenten: Den Vater und den Sohn. Er ist der jüngere von zwei Söhnen, der in die Geschichte als der Verlorene Sohn eingegangen ist. Dieser fordert vom Vater sein Erbteil und zieht in die Welt. Der ältere bleibt wie er war zu Hause. Die Geschichte endet mit der Rückkehr des Sohnes, aber mit welcher Dramatik. Als das Geld zu Ende ist, weiß er nicht mehr weiter. Er leidet Hunger, hat keine Perspektive mehr, keine richtige Arbeit. Ich stelle mir diese Situation ganz realistisch vor. Welche Optionen hat man in einer solchen Lage?
Eine Rückkehr nach Hause scheint aus mehreren Gründen prekär. Dem Sohn ist sicherlich das Ausmaß seines Verhaltens bewusst: Er hat ein großes Erbe vergeudet, vielleicht das Ansehen der Familie beschädigt, seine Gesundheit riskiert und vieles mehr. Angst hält ihn zurück, vor Strafe, vor Spott, Scham, vor sich selbst und den anderen. Schließlich aber rafft er sich doch auf: "Ich will aufbrechen," heißt es in der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, "und zu meinem Vater gehen!" Im griechischen Urtext steht: anastás poréusomai pros ton patéra mou… (Lk 15,18) Anastas, auf-stehen, das ist das gleiche Wort wie "Auf-erstehen" – anastasis". Umkehr hat mit Auferstehung zu tun. Ja, der Entschluss zur Umkehr, zur Richtungsänderung ist schon der Beginn dieser Auferstehung, zeigt schon das neue Leben am Horizont.
Was tut nun der Vater? Er sieht seinen Sohn "schon von weitem kommen": Seine Reaktion ist zuerst nicht Freude, sondern das Evangelium spricht vom Mitleid, vom Erbarmen. Splanchnízomai entspricht dem Hebräischen Ruchamáh – das Innerste des Menschen, seine Eingeweide sozusagen, geraten in Bewegung. Und diese Bewegung meint ein Sehen mit den Augen des Herzens, ein vollkommenes Erfassen der Situation des Gegenübers, Einfühlung. Und sogleich findet sie ihren Ausdruck: Der Vater läuft dem Sohn entgegen. Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn – noch ehe der Sohn Zeit hat, dem Vater die Selbstanklage vorzutragen, die er sich bereits beim Entschluss zur Rückkehr zurechtgelegt hatte. "Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Taglöhner." – Doch soweit lässt ihn der Vater gar nicht reden. Ab jetzt heißt es nur mehr. Schnell! Bringt ihm das beste Gewand, einen Ring, Schuhe, schlachtet das Mastkalb! Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir wollen feiern! Keine Strafe, keine Moralpredigt. Stattdessen Umarmung, neue Einkleidung und ein großes Fest. Ist das nicht unglaublich?
Dieses Evangelium gilt in der Tradition der Kirche als eines der schönsten Gleichnisse Jesu und als ein Sinnbild für die Feier des Sakraments der Versöhnung. Gott als der Barmherzige Vater, der einem zerlumpten Heimkehrer wortlos vergibt und mit allen im Haus ein großes Fest der Freude gibt. So schwer es mir persönlich bisweilen auch fallen mag, an die Vergebung all meiner Fehler zu glauben, so sehr spricht mir doch dieses Gleichnis ins Herz, dass es wahr ist.