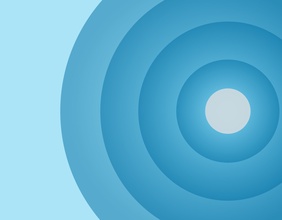Leopold Museum: Trotzdem Kunst 1914-1918
Der Erste Weltkrieg war wie nie zuvor auch ein Krieg der Bilder. Allein in Österreich waren mehrere hundert Künstler in die Bildproduktion zu Kriegszwecken involviert. Auch heute noch berühmte, wie Schiele, Egger-Lienz und Anton Kolig. Diese drei stehen im Zentrum einer Ausstellung, die heute in Wien eröffnet wird: "Trotzdem Kunst". Es ist der Beitrag des Leopold-Museums zum Gedenken an 1914.
26. April 2017, 13:56

(c) Schimmer, ORF
Morgenjournal, 8.5.2014
Die Kriegsleiden des Malers Schiele
„Trotzdem Kunst“. Und wie! Die Vitalität der Wiener Moderne kam nicht so einfach zum Stillstand, als 1914 der Krieg erklärt wurde. Der 52-jährige Gustav Klimt musste nicht mehr einrücken und malte weiter seine friedvollen Porträts und Landschaften, als wäre nichts geschehen. Vielleicht Eskapismus, vielleicht aber auch ein Sich-Verweigern. Manch anderer ließ sich für gemalte Propaganda einspannen, Klimt nicht. Auch Egon Schieles Äußerungen aus dieser Zeit lassen merken, dass ihm der Krieg gestohlen bleiben konnte. Wegen seiner zerbrechlichen Konstitution wurde der 24jährige für den Kanzleidienst rekrutiert und nicht als Kämpfer. Ihm reichten schon die ersten paar Wochen als Soldat: da schlief er in einem Massenquartier in Prag unter schlechten sanitären Bedingungen. Er habe „Die 14 schwersten Tage seines Lebens“ durchgemacht, beschwerte er sich. Später aber, als er Schreibarbeiten erledigte und Kriegsgefangene bewachte, da hatte Schiele verhältnismäßig viel Freiraum, erklärt der Ausstellungskurator Stefan Kutzenberger: "Erstaunlich ist, wie er auch im Krieg immer seine künstlerische Karriere vorantreibt. Was er für ein Netzwerkdenken gehabt hat – man könnte ihn heute vielleicht sogar als "Kunstmanager" übersetzen. Er ist also im Krieg in der Kanzlei gesessen und hat Briefe geschrieben, um Ausstellungen vorzubereiten und seine Bilder zu bewerben."
Traumposten: Kriegsmaler
Statt weibliche Aktmodelle malte und zeichnete Schiele plötzlich reihenweise Männer, und das durchaus gern. Als Künstler interessierten ihn die Köpfe der russischen Offiziere, die er im Gefangenenlager Mühling bei Wieselburg zu bewachen hatte. Vergebens mühte er sich, in die Kunstgruppe des Kriegspressequartiers versetzt zu werden: "Wenn man im Kriegspressequertier offizieller Kriegsmaler war, hatte man die besten Bedingungen: man musste zwei Wochen zeichnen, nicht direkt an der Front , Frontnähe reichet, und hatte dann wieder Urlaub, um die Bilder auszuführen."
Albin Egger-Lienz glückte schon 1915 die Aufnahme als offizieller Kriegsmaler; davor hatte aber er an der italienischen Front sehr viel mehr vom Krieg erlebt als Schiele. Seine Empathie für die Opfer gipfelt in dem berühmten Großgemälde „Finale“: Ausgemergelte tote Leiber mit klaffenden Mündern, ineinander verkeilt auf fahler Erde.
Schöngeistige Kriegsherren
Auf die Kriegskunst von vor 100 Jahren nehmen im Leopold-Museum auch zeitgenössische Künstler Bezug. Zum Beispiel der Belgrader Rasa Todosijevic, Jahrgang 1945, mit einem riesigen Wandkreuz, bestehend aus vier Badewannen mit einer breiten Blutspur. Der Kurator Ivan Ristic ahnt, worauf die Arbeit anspielt: "Darauf, dass die Serben ihren Leidensweg während des Weltkrieges – Serbien hat ja im ersten Weltkrieg ein Drittel seiner Bevölkerung verloren – sehr oft als Golgata bezeichnen. Es herrscht darüber in Serbien nach wie vor ein religiöser Diskurs."
Im neutralen Schweden präsentierte sich Österreich mitten im Krieg mit einer großen Avantgardekunstausstellung, in der auch Klimt und Schiele prominent vertreten waren. Der Krieg blieb ausgeblendet. So, als hätte die k. und k. Kulturnation keinem ein Haar gekrümmt.