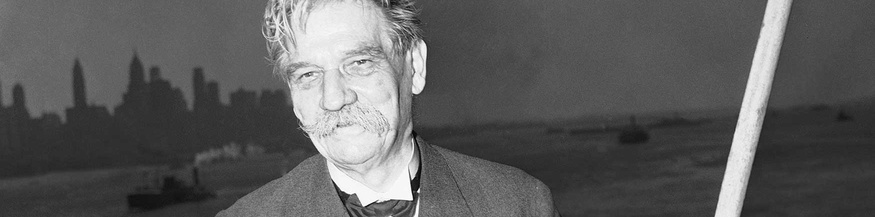Die Geschichte einer Stadt
Sarajevo
Sarajevo ist Symbol für zwei Gegensätze - das friedliche Zusammenleben von Nationen und Religionen - aber zwei Mal ist es im 20. Jahrhundert zum Symbol für Hass und Gewalt geworden, 1914 und in den 1990er Jahren, als umkämpfte und belagerte Stadt.
26. April 2017, 13:56
Sarajevo ist weder besonders groß - eine halbe Million Einwohner, einschließlich des Umraums - noch bemerkenswert alt: gegründet erst Mitte des 15. Jahrhunderts; geradezu jung im Vergleich mit etlichen bedeutend älteren Siedlungen am Balkan. Doch Sarajevo bewahrt etwas, das anderswo mit dem Ende des Osmanischen Reichs und dem Entstehen der Nationalstaaten verloren gegangen ist.
"In allen befreiten osmanischen Staaten sind die Hauptstädte fast total entosmanisiert worden - da ist Sarajevo ein Sonderfall, das gibt es sonst kaum wo", sagt Holm Sundhaussen. "In Belgrad, Sofia oder Athen findet man ja kaum noch etwas aus dieser osmanischen Zeit - als ob sie nicht existiert hätte. Als ob 4- bis 500 Jahre nicht existiert hätten."
Einst eine umjubelte Stadt
Sarajevo entstand als osmanische Neugründung, malerisch gelegen in einem Tal des Dinarischen Gebirges. Wie in einem Amphitheater schauten die Wohnviertel, Mahala genannt, auf ein rasch wachsendes Handelszentrum, von dem Besucher schwärmten:
Zitat
Sie priesen die hohe Lebensqualität in Sarajevo, die reine Luft, das saubere Wasser, die guten Weine, das reiche Warenangebot oder das pittoreske Ensemble der Stadt.
Der berühmteste türkische Reisende des 17. Jahrhunderts, Evlija Celebi, berichtete von über hundert Moscheen und Gebetshäusern, 180 Koranschulen, 47 Derwisch-Konventen und sechs öffentlichen Armenküchen; er zählt sieben steinerne Brücken über das Flüsschen Miljacka, 23 Herbergen und drei große Karawansereien. Und im gemauerten Markt - für den französischen Reisenden Quiclet schlicht "ein Wunder" - zählt Celebi nicht weniger als 1.080 Läden.
Zitat
"Muster von Schönheit", in denen man Waren aus Indien, Arabien, Persien, Polen und Böhmen erstehen könne.
Celebi vergleicht den Markt, die Carsija von Sarajevo, mit dem Bazar von Aleppo. Doch besonders angetan hat es ihm das Wasser.
Zitat
Er spricht von über 110 öffentlichen Wasserspeiern, 300 türkischen Brunnen in Form eines Kiosks, 700 Ziehbrunnen, 76 Wasserleitungen, fünf öffentlichen und 670 privaten Bädern. Die Zahl der Gärten beziffert er auf 26.000 (!), alle mit fließendem Wasser.
Soziale Einrichtungen und religiöse Stiftungen
Mit Zahlen muss man vorsichtig sein, warnt der Historiker Holm Sundhaussen. Doch zweifellos war das Sarajevo der ersten 200 Jahre eine attraktive, blühende Stadt. Unter anderem gab es hier ein öffentliches Wasserklosett, lange bevor es in England erfunden wurde.
Am Beispiel Sarajevos beschreibt Sundhaussen Elemente osmanischer Stadtkultur, Stadtplanung und Architektur, er beschreibt aber auch die Bedeutung wichtiger sozialer Einrichtungen, wie der religiösen Stiftungen, denen Sarajevo seinen Aufschwung verdankte, oder die Rolle der Sufi-Derwische - führend in der Seelsorge und auch bei der Islamisierung der unterworfenen Christen.
"Die christliche und jüdische Gemeinschaft in Sarajevo war so minimal - das ändert sich dann erst im 19. Jahrhundert -, dass die Hierarchie zwischen den Religionsgemeinschaften überhaupt nicht in Frage gestellt werden konnte", so Holm Sundhaussen. "Natürlich, jeder der in Sarajevo lebte, wusste, dass es da Christen und Juden gab, und auf dem Markt begegnete man sich wechselseitig, aber das kulturelle Leben war völlig separiert; es gab keinen interkulturellen Dialog zwischen den Führungsschichten von Muslimen, Katholiken, Orthodoxen und Juden; nicht, ein Muslim konnte sich mühelos mit einem anderen Muslim in Istanbul oder Aleppo oder weiß ich wo verständigen, aber mit den Eliten der Christen und Juden vor Ort gab es keinerlei geistige Auseinandersetzung."
Ein Nebeneinander der Religionen
Holm Sundhaussen rückt einen Mythos zurecht: Das berühmte interkulturelle Sarajevo sollte erst im 20. Jahrhundert entstehen, erst in den wenigen Jahrzehnten des sozialistischen Jugoslawiens, als Religion zur Privatsache erklärt wurde und in den Hintergrund rückte. Zu seiner osmanischen Blütezeit lebten die vier Religionen - Muslime, Katholiken, Orthodoxe und Juden - mehr neben- als miteinander. Glocken durften nicht geläutet, keine neuen Kirchen gebaut werden. Christen und Juden durften keine Muslimin heiraten. (Vor allem lasteten auf Nichtmuslimen hohe Kopfsteuern - die sie allerdings auch schützten. Ein Massenübertritt von Christen zum Islam hätte die ökonomische Grundlage des Osmanischen Reichs erschüttert.)
Zitat
Religiöser Pluralismus und Gleichberechtigung war den Staats- und Gesellschaftsmodellen der Frühen Neuzeit fremd. Duldung - ein erster Vorläufer des Minderheitenschutzes - war unter diesen Umständen das Maximum. Sie war Teil jener pragmatischen und flexiblen Machtpolitik, die dem Osmanischen Reich zu Aufstieg und Glanz verhalf.
Symbolische Besetzung
Der Glanz Sarajevos endete im Jahr 1697. Auf die zweite, aus osmanischer Sicht erfolglose Belagerung Wiens folgte der Große Türkenkrieg der Heiligen Liga, in dessen Verlauf Prinz Eugen von Savoyen nach Sarajevo kam. In seinem Kriegs-Tagebuch beschrieb er die Stadt als "sehr groß", "völlig offen", "mit 120 sehr schönen Moscheen", dann legte er sie in Schutt und Asche.
Eugens Überfall auf eine wehrlose Stadt war gewiss keine Ruhmestat des Edlen Ritters, schreibt Sundhaussen, wenn sie auch damaligen Gepflogenheiten entsprach. Sarajevo wurde wieder aufgebaut, aber nicht vollständig. Die Zerstörung der Stadt war ein Wendepunkt, die Spätzeit des Osmanischen Reichs gekennzeichnet von Korruption, dem Aufstieg lokaler Machthaber und wirtschaftlichem Niedergang.
Als das Reich endlich reformiert und zentralisiert werden sollte, kam es zu bewaffneten Aufständen bosnischer Eliten. Das Verhältnis der Religionsgemeinschaften in Sarajevo verschlechterte sich paradoxerweise gerade durch Reformen wie mehr Gleichberechtigung für alle Religionen. Die muslimische Mehrheitsbevölkerung fühlte sich bedroht durch neue Kirchtürme, die höher als Minarette werden sollten.
"Das Entscheidende ist die symbolische Besetzung des Raums; sowohl die visuelle, was die Höhe des Turms betrifft, als auch die akustische", meint Holm Sundhaussen. "Bei der Einweihung der neuen Metropolitankirche durfte z. B. die große Glocke nicht läuten, es durfte aber die Glocke der alten Kirche läuten, die in der Nähe war. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten konnte man nun in Sarajevo das Christentum hören - das war etwas Unerhörtes, die Muslime trauten ihren Ohren nicht. Genau wie bei uns Minarette - löst bei uns Proteste aus -, genauso war es auch in Sarajevo; die Atmosphäre war extrem aufgeheizt."
Unter österreichischer Herrschaft
Im Sommer 1878 teilte der Berliner Kongress Bosnien Österreich-Ungarn zur Verwaltung zu. Am 19. August nahmen kaiserliche Truppen die Stadt ein, gegen erbitterten Widerstand.
Zitat
Die k.-u.-k.-Soldaten mussten sich von Straße zu Straße vorkämpfen und töteten gnadenlos alle, die sich ihnen in den Weg stellten, ein schreckliches Gemetzel.
Die Zeit des österreichischen Sarajevo begann schlecht, auch geschuldet einem antimuslimisch agierenden Kommandanten Josip Filipovic. Und doch waren die vier Jahrzehnte unter dem Dach der Donaumonarchie prägend für die Stadt, die damals ein zweites Gesicht erhielt: Verwaltungs- und Repräsentativbauten, die an die osmanischen Viertel anschlossen, ohne sie zu zerstören. Die österreichisch-ungarische Verwaltung war darauf aus, auch die muslimische Bevölkerung zu gewinnen und das osmanische Erbe zu bewahren, bilanziert Holm Sundhaussen. Vor allem im Rückblick wurde die österreichische Ära positiv bewertet - nach 1918, als Bosnien Teil des jugoslawischen Königsreichs wurde.
"Bosnien und auch Sarajevo gerieten in eine absolute Verfallsperiode. Wiewohl Bosnien eine zentrale Lage innerhalb des Königreichs Jugoslawien hatte", so Holm Sundhaussen. "Selbst bosnische Serben haben das immer wieder beklagt: 'Eigentlich war die österreichisch-ungarische Zeit viel besser, von Befreiung merkt man nichts.'"
Aufschwung und Katastrophe im 20. Jahrhundert
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Sarajevo ein zweites Mal, wie zu Beginn seiner Geschichte, Aufschwung und Katastrophe. Auf staatliche Unterdrückung des religiösen Lebens folgte noch unter kommunistischer Herrschaft eine gewisse Förderung namentlich der muslimischen Gemeinschaft, unter anderem wegen der jugoslawischen Kontakte zu blockfreien muslimischen Staaten.
Es war zugleich die wohl einzige Periode, in der die verschiedenen Religionsgemeinschaften der Stadt tatsächlich ohne oder nur mit minimalen Spannungen zusammenlebten. Die olympischen Winterspiele 1984 erlebten viele Einwohner als Höhepunkt der Stadtgeschichte. Im Jahrzehnt darauf wurde das belagerte Sarajevo zum Symbol für nationalen Hass, Gewalt und Krieg - Jahre, von denen sich die Stadt auch zwei Jahrzehnte danach noch nicht erholt hat, meint ihr Biograph Holm Sundhaussen.
Service
Holm Sundhaussen, "Sarajevo. Die Geschichte einer Stadt", Böhlau Verlag