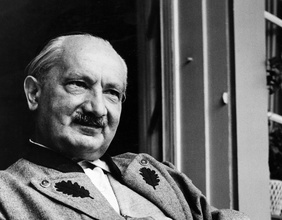"Luci mie traditrici" - erste Festwochen-Premiere
Donnerstagabend sind die Wiener Festwochen eröffnet worden, am Samstag folgt mit Salvatore Sciarrinos "Die tödliche Blume" die erste Premiere: Für die Neuinszenierung zeichnet mit Achim Freyer ein bildender Künstler, Bühnenbildner und Regisseur verantwortlich. Unter der musikalischen Leitung von Emilio Pomarico spielt das Klangforum Wien.
26. April 2017, 12:23
Die Uraufführung 1998 wurde von der bildenden Künstlerin Rebecca Horn in Szene gesetzt.
Mittagsjournal, 15.5.2015
1590 ertappte der Komponist Carlo Gesualdo seine Frau und ihren Geliebten in flagranti und ermordete die beiden. Auf dieser wahren Begebenheit beruht Salvatore Sciarrinos Oper in zwei Akten rund um Herzog und Herzogin Malaspina. Der sprechende Name - "Malaspina" bedeutet "böser Dorn" - nimmt den tragischen Ausgang schon vorweg, ebenso die eröffnende Elegie des Renaissancekomponisten Claude Le Jeune.
"Die tödliche Blume", im Originaltitel "Luci mie traditrici" (meine verräterischen Augen), ist ein filigranes Werk, in dem die Musik erzählt, wovon die knappen, abgehackten Dialoge nicht zu sprechen vermögen.
Regisseur Achim Freyer schuf dazu eine Bühnenwelt auf drei übereinander schwebenden Feldern in Rautenform. Die Figuren in venezianischen Masken stehen wie angewurzelt jeweils auf einer Ecke ihres Feldes. In der Mitte Herzogin Malaspina; unter ihr balanciert der Herzog, in Seilen gefangen, in einer Art Hochseilgarten. Über ihnen der Diener als alles überblickender Spion, der das außereheliche Liebesspiel mit dem auftauchenden Gast verrät und so die Tragödie veranlasst.
"Hättest du geschwiegen, wäre ich nicht entehrt. Nun muss ich sie töten", wirft ihm der vor Liebe und Eifersucht glühende Herzog vor, erst nach langem Zögern folgen dem Entschluss auch Taten. Für Achim Freyer verbirgt sich darin die tatsächliche Dimension des Dramas um Liebe, Eifersucht und Ehrenmord.
Freyer stellt der Oper in acht Bildern die Groteske "Tag aus Nacht ein" als pantomimischen Prolog voran. In jeweils kurz aufflackernden Bildern wird darin die Geschichte unter umgekehrten Vorzeichen erzählt: sie entlarvt ihn als Ehebrecher und tötet ihn. Bei Freyer wie bei Sciarrino steht am Ende kein donnernder Operntod, sondern ein stilles Dahinscheiden, das der Regisseur mit wenigen Lichteffekten zu einem großen Bild herausarbeitet.