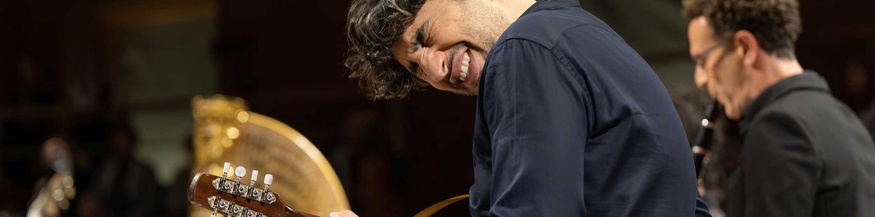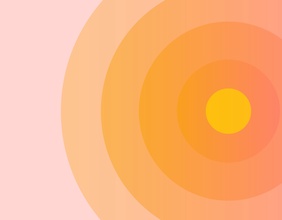Kurzessay zu Johannes 18, 33b – 37
Das Johannesevangelium wurde circa 70 Jahre nach Jesu Tod niedergeschrieben, es soll verstehen helfen, wer Jesus war und was seine zentralen Anliegen waren.
8. April 2017, 21:58
Es geht bei dieser kurzen Gesprächsszene zwischen Pilatus und Jesus nicht um ein Protokoll des Verhörs, sondern um den Versuch, Jesus und seine Botschaft zu verstehen.
Die Frage „Bist du der König der Juden?“ eröffnet das Feld: Es geht um Macht. Pilatus ist im autoritär-hierarchischen System des Römischen Reiches zu Hause. Der römische Kaiser hat Statthalter in den Provinzen, für die jüdische Bevölkerung ist dies König Herodes, dieser hat den Willen des Kaisers vor Ort umzusetzen. Pilatus wiederum vertritt den König vor Ort. So funktioniert dieses System der Macht. Pilatus wird hier überraschend fragend und zögerlich dargestellt, verantwortlich für die Auslieferung und das Verhör seien „dein, d.h. Jesu Volk und die Hohepriester“.
Diese so verhängnisvollen Verse sind verantwortlich für eine entsetzliche Zuordnung der Schuldfrage über Jahrhunderte hinweg. Aus heutiger Sicht ist absolut klar, dass nicht „die Juden“ schuld sind an Tod Jesu, sondern dass die Nennung der Juden die damalige Auseinandersetzung zwischen Juden und Christen um ca. 100 n.Chr. widerspiegelt, und dass diese Formulierung die römischen Machthaber schont und einen Konflikt mit diesen verhindert.
Aus heutiger Sicht ist diese Szene vor Pilatus hoch spannend, was den Verlauf anbelangt. Selbstverständlich ist zuerst Pilatus gesprächsführend, aber bereits mit der ersten Antwort übernimmt Jesus die Führung, indem er auf die Frage des Pilatus eingeht und zugleich darüber hinausgeht. Weil Jesus das Verständnis von „König“ und „Macht“ und „Herrschaft“ verändert und sich nicht auf einen Kampf um diese Macht einlässt, verwirrt er. Und offensichtlich verwirrt Jesus mit diesen Worten nicht nur Pilatus damals, sondern Menschen bis heute.
Das Bild eines Königs hat sich verändert, Könige sind heute in Märchen und in der Klatsch-Presse zu finden. Das damalige Bild des Königs lässt keinen Zweifel: Es geht um Herrschaft und Macht, es geht um Willkür und Ausbeutung, es geht darum, dass einer über den Anderen bestimmen kann – auf Leben und Tod. Und damit wird Jesu Botschaft wieder sichtbar: Nein. Macht und Gewalt haben nicht das letzte Wort. Es ist möglich, die Welt zu verändern, es ist möglich, die Hand zu reichen, wo man auch zuschlagen könnte, es ist möglich, genau hinzuschauen – und die Welt ein bisschen zu verändern. Jesus redet davon zu bezeugen, was „wahr“ ist, mit Worten und Taten, mit seinem ganzen Leben.
Ingeborg Bachmann formuliert es im Gedicht „Anrufung des Großen Bären“ von 1956 so: „Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen, was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten, was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. …“
Kurz vor seinem Tod wird Jesus gezeigt als einer, der sich nicht in Fragen von Herrschaft und Macht verstricken lässt, der klar sieht und bezeugt, was er sieht, damit sich etwas verändern kann. Mich fordert das: Hinsehen und bezeugen – und verändern, was möglich ist.