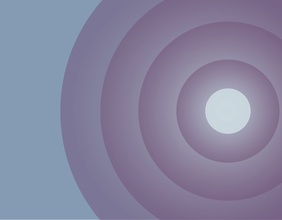Baukultur in Spanien: die produktive Krise
Die Wirtschaft Spaniens befindet sich im Aufwind. Mit rund drei Prozent liegt das Wirtschaftswachstum des einstigen europäischen Sorgenkinds über dem EU-Schnitt. Vor der Krise erlebte Spanien einen noch nie dagewesenen Bauboom. Entlang der Mittelmeerküste zeugen bis heute Investitionsruinen von diesem Boom, der mit der Finanzkrise ein jähes Ende gefunden hat.
8. April 2017, 21:58
Kulturjournal, 14.12.2015
Man sieht einen Golfspieler beim Abschlag. Die Kamera schwenkt über grüne Rasenflächen und fokussiert ein Häusermeer, das in einem feinsäuberlichen Raster angeordnet ist. "Spanien ist eines der Länder, in dem sich die Immobilienblase am intensivsten entwickelt hat. Man kann von einer gewaltigen Verstädterung sprechen, von einem Zement-Tsunami, der die spanischen Küsten und Inseln überrollt", sagt Rámon Fernandéz Durán, Urbanist an der Universität Madrid. In Erwin Wagenhofers Dokumentarfilm "Let's Make Money" spricht er über die Folgen des spanischen Immobilienbooms, der zu einem großen Teil von internationalen Investoren finanziert wurde und zeitverzögert auch den so genannten kleinen Häuslbauer erreichte.
Es wurde zügellos gebaut. Auf Pump
In Spanien wurde in den Jahren vor der Krise zügellos gebaut. Auf Kredit. Bungalows und Apartments. Riesige Bettenburgen. Größer, höher, teurer. Das hässliche Gesicht dieser Wachstumsspirale ist heute vor allem entlang der spanischen Mittlermeerküste zu sehen. Wer den Bus von Barcelona nach Malaga nimmt, sieht wie sich die Spur der turbokapitalistischen Verwüstung ihren Weg gebahnt hat. Immer wieder sieht man Investitionsruinen.
"Die meisten sind nicht fertig gebaut worden. Sie werden nicht genutzt. Es ist teuer sie abzureißen. Also bleiben sie stehen. Sie sind wie ein Mahnmal in der Landschaft. Sie erinnern an eine Zeit, als die Bauwirtschaft in Spanien verrückt geworden ist. Denn man hat gebaut, ohne auf die Bedürfnisse der Menschen zu achten. Bauen war Big Business. Und niemand in Spanien ist in der Lage gewesen, diesen Wahnsinn zu stoppen", sagt Architekt Ruíz Allén. Er hat ein kleines Architekturbüro mit Sitz in Asturias und Madrid und beschäftigt sich damit, wie die junge Architekturszene Spaniens versucht, aus der Krise zu lernen.
Spanien gilt mit einer prognostizierten Wachstumsrate von rund drei Prozent heute zwar wieder als Musterschüler unter den südeuropäischen Krisenländern, die Arbeitslosigkeit liegt aber nach wie vor bei 22 Prozent. Noch alarmierender ist die Zahl bei den Jungen. Jeder zweite Spanier unter 25 Jahre steht ohne Job da. In dieser allgemeinen wirtschaftlichen Situation sind Aufträge für junge Architekten eher rar.
"Als Architekten sind wir mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert. Überall im Land findet man leere Gebäude, ja ganze Gebäudekomplexe, die nie fertiggebaut worden sind. Manche Landstriche in Spanien sind viel zu schnell gewachsen. Ich selbst komme aus dem Norden Spaniens. Dort findet man keine Investitionsruinen. An der Mittelmeerküste sieht es freilich anders aus", sagt Ruíz Allén. Im Augenblich lehrt er an der Universität im dänischen Aarhus. Dort beschäftigt er sich auch mit einer jungen Architektengeneration, die es verstanden hat, die Krise produktiv zu machen. Was das bedeuten soll, veranschaulicht eines der spanischen Vorzeigeprojekte. Es befindet sich in Madrid.
Die Agora in der Baulücke
"Am Campo de Cebada hat wahrscheinlich Vieles begonnen, was die junge spanische und internationale Architekturszene heute umtreibt. Im Zentrum dieses Trends stehen Bürgerbeteiligung und die Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen", sagt Architekt Ruíz Allén über den Campo de Cebada, der längst über die Stadtgrenzen Madrids hinaus berühmt ist. Der Campo de Cebada ist ein Ort in Madrids Stadtteil La Latina, ein Versammlungsplatz, den Aktivisten und Freiwillige in einer ehemaligen Baulücke eingerichtet haben.
Eigentlich hätte an der Stelle, an der heute Sport getrieben wird und Gemeinschaftsgärten angelegt werden, ein neues Sportzentrum gebaut werden sollen. Als die Krise Spaniens Wirtschaft und vor allem Bauwirtschaft zum Erliegen brachte, fehlte das Geld. Die riesige Baulücke wurde eingezäunt: 5.500 Quadratmeter Brachland mitten im belebten La Latina. Das wollte so mancher Anrainer, so mancher Anrainerin nicht akzeptieren. "Ich mag den Campo de Cebada, weil er ein multifunktionaler Raum ist. Hier ist fast alles möglich. Ohne das 'fast' wäre es eine Utopie. Wir pflanzen während unserer Finanzierungsmeetings Tomaten und hören gleichzeitig einem Gitarrenspieler zu. Das hat was!", sagt eine Anrainerin.
Aktivisten und Aktivistinnen besetzten den Campo de Cebada und machten daraus einen Ort der kommunalen Begegnung. Bürgerversammlungen finden hier statt, Sportveranstaltungen, Ausstellungen. Es wird gefeiert, diskutiert und gestritten. Der öffentliche Raum als Agora. Als Ort der Begegnung und Versammlung. Ein ideal der Stadtplanung scheint am Campo de Cebada verwirklicht. "Die Architekten, die an dem Projekt beteiligt sind, kommen aus der Nachbarschaft", erklärt Ruíz Allén. "Es ist ein Projekt der Bürger und Bürgerinnen, die eine Leerstelle im Stadtraum in Besitz genommen haben, um dort neue Formen der Nutzung zu erproben. Sie orientieren sich an den Bedürfnissen der Nachbarschaft".
Ruíz war vergangene Woche auf Einladung des Architekturnetzwerks Niederösterreich zu Gast in Wien. Seinem Vortrag stellte er ein Bonmot des Schweizer Schriftsteller Max Frisch voran: "Eine Krise", schrieb der, "ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen."