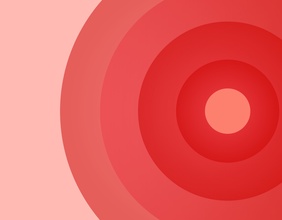Bibelessay zu Johannes 13,31 - 35
Die Szenerie ist angespannt, eine Ruhe vor dem Sturm. Das letzte Mal sitzt Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen. Es ist der Vorabend des Pascha-Festes, an dem die Juden der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten gedenken und das Passa-Lamm schlachten.
8. April 2017, 21:58
Kurz zuvor hat Judas Iskariot den Raum verlassen, um Jesu Aufenthaltsort an die Soldaten zu verraten. Der gewaltsame Tod am Kreuz steht bevor. Jesus hat ihn angekündigt, ja ihn selbst noch provoziert. Er hat Judas aufgefordert, sofort zu tun, was er tun möchte.
In diesem von drohender Gewalt durchzogenen Setting redet Jesus von Liebe. Er nimmt Abschied mit eine Aufforderung: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. In der feindlichen Umgebung sollen die Jüngerinnen und Jünger eine Liebesgemeinschaft bilden – ein krasses Gegenbild zu einer Gesellschaft, in der gehasst, vertrieben, totgeschlagen wird. Ein geschützter Raum soll diese Gemeinschaft sein, ein Ofen, der nach innen wärmt und die Kälte, das feindliche Draußen abhält. Immer wieder hat man den Text so verstanden. Eben das sei die christliche Nächstenliebe – sie richte sich an die eigene Gruppe, das eigene Volk, diejenigen, die einem ähnlich und ihrerseits wohlgesonnen sind.
Es lohnt sich, dieses Liebesgebot im Kontext des Evangeliums genauer anzuschauen. Die Liebe, mit der Jesus seine Jüngerinnen und Jünger beauftragt, ist gebunden an ihn selber. Sie sollen in der Weise lieben, wie er sie geliebt hat. Wiederum kurz zuvor hat Jesus für Judas Iskariot ein Stück Brot eingetunkt und ihm zu essen gegeben. Er tut dies in dem Wissen, dass Judas ihn verraten wird. Wie auch immer das Verhältnis des Judas zu Jesus in der Vergangenheit war – in dem Moment ist er sein Todfeind. Dennoch lässt Jesus ihn am Mahl teilhaben, bezieht ihn in die Gemeinschaft ein, bedient ihn sogar. Auch Petrus erscheint in der Szene als durchaus unsicherer Kandidat. Noch bevor es Morgen wird, so prophezeit Jesus ihm, wird er dreimal verleugnen, dass er etwas mit Jesus zu tun hat. Zu der Liebe, die Jesus erweisen wird – nämlich sein Leben hinzugeben, ist Petrus zumindest für den Moment noch nicht fähig. Auch die übrigen Jüngerinnen und Jünger sind wankelmütig. Sobald es ernst wird, werden die meisten von ihnen davonlaufen. Damit ist die Trennung zwischen Innen und Außen, zwischen Freunden und Feinden in dieser Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger durchaus unklar. Es gibt nicht erst die Gemeinschaft, die dann einander lieben soll, sondern die Liebe schafft erst die Gemeinschaft, die sich nach der Auferstehung wieder neu zusammenfinden wird.
In dieser Gemeinschaft soll keiner über den Anderen herrschen. Wie Jesus, der den Jüngerinnen und Jüngern die Füße gewaschen hat, soll jeder sich neu zum Sklaven des Anderen machen. Eben diese Liebe soll, so sagt es Jesus, ein Zeichen für die ganze Welt sein. Sie ist damit kein Wohlfühlprogramm für einen Kreis der Auserwählten, kein Abschottungsmechanismus, der die Fremden und Feinde draußen hält. Eine solche Liebe zeigt in einer Welt, in der Menschen oft nur ihr Eigenes kennen, dass anderes möglich ist.