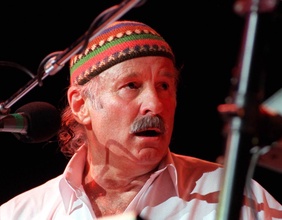Prämierte Groteske "Chevalier" im Kino
Die griechische Regisseurin Athina Rachel Tsangari begleitet in ihrem neuen Spielfilm "Chevalier" sechs Männer auf einem Jachtausflug. Aus Langeweile bewerten sie einander auf der Suche nach dem Besten. Die Groteske über männliches Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken wurde beim London International Filmfestival als bester Film ausgezeichnet.
8. April 2017, 21:58

THE MATCH FACTORY
Die neue griechische Welle
Ein griechischer Spielfilm über einen Bootsausflug im Mittelmeer - da denkt man zuallererst an Flüchtlinge und Finanzkrise. Nicht so im Film "Chevalier": das Boot ist da eine Jacht, und die Krise - zumindest die Politische und Wirtschaftliche - ganz weit weg. 2010, als sich gerade die Dimensionen der griechischen Staatsmisere abzuzeichnen begannen, machte auf den internationalen Film-Festivals eine neue griechische Regiegeneration auf sich Aufmerksam, die mit einer oft analytischen Filmsprache, künstlerische Antworten auf den wirtschaftlichen Niedergang des Landes suchte. Eine der zentralen Figuren dieser "neuen griechischen Welle", wie sie damals beschrieben wurde, ist Athina Rachel Tsangari.
Eitelkeiten & Versagensängste
Wer hat den Längsten? In jeglicher Hinsicht. Regisseurin Athina Rachel Tsangari begleitet in ihrem neuen Film sechs Männer zwischen Ende 30 und Anfang 60 auf einem Jachtausflug. Das Licht winterlich weiß, wird die Idylle der griechischen Küste nur gelegentlich in das Bild geholt, in dessen Zentrum Tsangari wie in einem Reagenzglas die sechs Männer platziert.
Die Rückfahrt nach Athen verzögert sich und aus Langeweile beginnen sie ein Spiel. Sie bewerten sich gegenseitig, in allem, suchen den Besten der Gruppe, in jeglicher Hinsicht. Der Sieger soll am Ende den "Chevalier", einen Siegelring bekommen. Und schien bis zu diesem Zeitpunkt das, was nicht gesagt wurde wichtiger, als das was gesagt wurde, so wird nun alles vermessen und in die Waagschale geworfen.
Wie in einer Laborsituation seziert Tsangari die Männerrunde, treibt ihr Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken immer weiter auf die Spitze. Und weil die Regeln des Spiels so unklar definiert sind, seien auch Konflikte entlang persönlicher Befindlichkeiten vorprogrammiert, so Regisseurin Athina Rachel Tsangari: "Sie sind wie Kinder - versuchen die Bewertungen, den Respekt und die Sympathien der anderen zu gewinnen. Das machen wir aber alle, jeden Tag, und die Kriterien dabei sind subjektiv. Und darauf wollte ich hinaus: Dass jegliches Bewertungssystem subjektiv und willkürlich ist."
Herrlich absurde Szenen
In nüchternen Bildern, schwarzhumorig und frei von jeglichem Pathos beobachtet Tsangari die Männer, die sich in diesem Spiel der Eitelkeiten und Versagensängste immer weiter aus ihren Komfortzonen herausbewegen. Selbstzweifel wachsen mit den Egos, und es sind herrlich absurde Szenen, wenn Tsangari die Männer etwa dann filmt, wenn sie sich vor dem Spiegel stehend, stolz auf ihre Erektion oder sich selbst, "Ich bin der Beste" zurufen.
In "The Capsule", einem 35-minütigen Kurzfilm, stellte Tsangari zuletzt eine reine Frauenrunde ins Zentrum. "Chevalier" schließe an diese Arbeit an. "Das war ein Film über Machtdynamiken, wie Macht in einer Gruppe verteilt, übernommen und verformt wird. Diese Idee wollte ich jetzt auf eine Männerrunde übertragen, und zwar in einer abgeschlossenen Umgebung", erzählt die Regisseurin.
"Kein Film über Zustand des Landes"
Von der Staatskrise, auf die griechische Künstler derzeit wieder und wieder angesprochen werden, distanziert sich Tsangari dabei. "Chevalier" sei kein Film über den Zustand des Landes. Das hat zuletzt auch ihr Kollege Yorgos Lanthimos bei seiner dystopischen Satire "The Lobster" betont. Lanthimos arbeitet inzwischen in London, Tsangari in den USA, und beide wollen auch nicht auf die sogenannte neue Welle des griechischen Kinos reduziert werden, als deren zentrale Figuren sie gelten.
Aber Gemeinsamkeiten lassen sich nicht leugnen: Denn obwohl in "Chevalier" mit Stoffservietten gegessen, und auf der Yacht kredenzt wird, erzählt dieser Film doch viel über eine Gesellschaft in der Krise. Über den Wettbewerb der längst im Banalen angekommen ist, von Regeln, die fehlen oder nicht greifen. Und in diesen Fragestellungen, in den filmischen Herangehensweisen, die das Groteske suchen und jeglichen Naturalismus vermeiden, schließt sich auch wieder der Kreis zu jenem griechischen Kino, das seit einigen Jahren eine radikal eigene, nicht umsonst viel beachtete, Filmsprache eint.