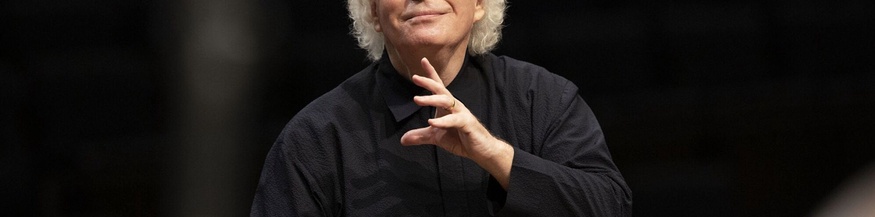"Sex and the City" im Filmmuseum
Wild und ungezügelt, politisch und sexuell aufgeladen war das US-amerikanische Kino Anfang der 1930 Jahre, bevor sich die großen Studios 1934 einer Selbstzensur unterwarfen. Das Wiener Filmmuseum zeigt ab heute 38 Beispiele: "Sex and the City: Pre-Code Hollywood".
8. April 2017, 21:58
Kulturjournal, 6.5.2016
Mit Einführung des sogenannten "Production Code" unterwarfen sich die großen Studios einer freiwilligen Selbstzensur. Das Wiener Filmmuseum präsentiert bis 19. Juni Schätze aus dieser turbulenten Kinophase: Knapp 40 Filme, von Regisseuren wie Michael Curtiz, William A. Wellman oder Alfred Green werden gezeigt, allesamt aus den Jahren 1930 bis 1934 und aus dem Hause Warner Brothers.
"Make it snappy" war das Motto
Es ist ein Hollywoodkino, das aus heutiger Sicht überraschend daherkommt, so Alexander Horvath, Direktor des Filmmuseums: überraschend in seiner Direktheit, mit seinen Motiven und Figuren, und wie diese erzählt und gezeigt werden.
Vielfach zensuriert und erst seit einigen Jahren wieder in seiner skandalträchtigen Urfassung zugänglich, erzählte etwa Alfred Green in "Baby Face" vom steilen Karriereweg einer jungen Frau, die sich ihren Weg auf der Karriereleiter durch die Hinterzimmer bahnt. Als verführerische Blondine holt sich Barbara Stanwyck den Beamten ins Chefbüro, bevor die Kamera über die Fassade, die Stockwerke nach oben schwenkt, und damit die Richtung vorzeigt, in die sich die Hauptfigur gerade schläft.
"Make it snappy" war dabei das Motto, das die rasante Machart der Filme vorgab. Frech und unbekümmert. Dabei war der "Production" oder "Hays Code" in seinen Grundrissen schon im Jahr 1930 festgeschrieben, war bis 1934 aber noch nicht bindend, und so nutzten die Filmemacher die Freiräume, die sich ihnen boten. Die Forderungen - vor allem kirchlicher Organisationen - nach moralischen Zügeln für die Filmbranche verliefen ins Leere. Dass die Studios sich 1934 dann selbst den "Production Code" auferlegten, war gewissermaßen Selbstzensur zum Selbstschutz.
Ab 1934 wurde Direktheit gezähmt
Mit der Wahl Roosevelts zum US-Präsidenten, der ab 1933 mit seiner New Deal Politik das Land politisch wie wirtschaftlich stabilisierte, griff der Staat zunehmend mit regulierenden Maßnahmen in den unterschiedlichsten Bereichen ein. Mit dem Production Code wurde eine "moralisch akzeptable" Darstellung besonders von Kriminalität und sexuellen Inhalten festgeschrieben, Obszönitäten wurde ein Riegel vorgeschoben, explizite Gewaltdarstellungen verboten.
Abgesehen davon, dass durch den Production Code auch die Effizienz gesteigert werden konnte, weil die Selbstzensur späteren Eingriffen durch die offiziellen Zensurbehörden zuvorkam, wurde das Kino in seiner Direktheit gezähmt. Und umso faszinierender ist der Blick auf die Filme dieser wilden Jahre vor 1934, die das Filmmuseum in seiner Schau präsentiert.
Es war ein Kino, das dabei tief im urbanen Raum verankert war, das in seinem Rhythmus und seinen Geschichten das städtische Leben widerspiegelte. So wird in Filmen wie "Union Depot" ein Bahnhof zum Mikrokosmos, in dem sich alles abspielt, von der Liebes- bis hin zur Gangstergeschichte.
Seine Stars fand das Pre-Code Kino dabei größten Teils auf den Straßen, und der Direktor des Filmmuseums hebt vor allem einen Namen hervor: James Cagney. Zwischen 1930 und 1934 spielte Cagney in rund 20 Filmen mit, und ihm verdankt das Pre-Code Kino auch eine seiner berühmtesten Szenen, wenn er im Gangsterepos "Public enemy" seiner nervenden Freundin beim Frühstück eine Grapefruit ins Gesicht drückt.
Kino als ungeschminkte Sozialkritik
Aber das Kino der frühen 30er Jahre präsentierte sich dabei auch ungemein politisch und gesellschaftskritisch. Im Film "Wild Boys of the Road" streifen zwei Burschen auf Arbeitssuche durch die USA - Hollywood Kino als ungeschminkte Sozialkritik. Kurz vor Filmende werden sie verhaftet und verhört - es wäre ein grausamer Schluss, quasi das Gegenstück zum Happy End, aber dann schwenkt der Richter um, verspricht die Freiheit, und: dass alles besser werden würde.
"Wild Boys of the Road" sei ein gutes Beispiel, so Alexander Horvath, wie das Kino schon vor Einführung des Production Code Gesellschaftskritik mit optimistischen Botschaften verband, die auch der allgemeinen Aufbruchsstimmung nach der Wirtschaftskrise gerecht wurden. Die Studios trugen so die Politik Roosevelts von Anfang an mit, und sendeten dann, mit Einführung des "Production Code" ein unmissverständliches Signal.
Erst 1967 wurde der "Production Code" wieder abgeschafft, und mit Filmen wie "Die Reifeprüfung" die New Hollywood Ära eingeleitet.
Service
Filmmuseum - Sex and the City
Pre-Code Hollywood: Warner Bros. am Zenit
6. Mai bis 19. Juni 2016