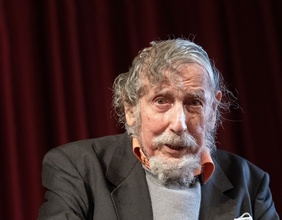2.400 Jahre Aristoteles
Für Hegel war er "eines der reichsten und tiefsten Genies", die je über die Probleme unserer Welt nachgedacht haben. Und das Mittelalter nannte ihn schlicht "den Philosophen": Aristoteles. Was ist nun das Besondere am Denken des großen Thrakers, dessen Geburtstag sich heuer zum 2.400. Mal jährt?
8. April 2017, 21:58
Die Unesco hat das Jahr 2016 zum internationalen Aristoteles-Jahr erklärt. In aller Welt werden Vorträge, Symposien, Workshops zu und über den bedeutenden Philosophen abgehalten, und in Saloniki wird ab heute ein Aristoteles-Weltkongress über die Bühne gehen.
Kulturjournal, 23.5.2016
Service
Hellmut Flashar, "Aristoteles - Lehrer des Abendlandes", C. H. Beck, München, 416 Seiten
Otfried Höffe, "Aristoteles", C. H. Beck, München, 330 Seiten
Aristotle World Congress
Erfahrungsoffener Denker
Gibt es eine Wissenschaft, die dieser Mann nicht erfunden oder maßgeblich mitgeprägt hätte? Aristoteles gilt als Begründer der abendländischen Logik, er war der Erste, der systematisch über Fragen der Ethik nachgedacht hat, er hat aber auch auf den Feldern der Geologie, der Sprachtheorie, der Literaturwissenschaft und der Politologie Epochales geleistet, von seinen Feldforschungen auf dem Gebiet der Zoologie ganz zu schweigen.
"Aristoteles bleibt für mich das Vorbild eines erfahrungsoffenen Denkers ...", bekennt der Tübinger Philosoph Otfried Höffe, der im Verlag C. H. Beck eine lesenswerte Einführung in das Denken des großen Thrakers veröffentlicht hat. Dorothea Frede von der Uni Hamburg pflichtet ihrem Kollegen bei: "Aristoteles kann man wirklich als Universalgenie bezeichnen. Er hat ja nicht nur die Logik erfunden, er hat praktisch alle Wissenschaften erfunden, dadurch, dass er die Gegenstände erfunden und sich über die Methodik Gedanken gemacht hat. Auf diese Weise ist er nicht nur der Vater der Ethik und der Politik, sondern auch der Biologie, der Physik und der Psychologie geworden. Mit Ausnahme der Mathematik gibt es kein Gebiet, auf dem Aristoteles nicht Bahnbrechendes geleistet hätte. Und das hat ihm niemand für Jahrhunderte und Jahrhunderte nachtun können."
Ein Klassiker, gut und schön. Wo aber vermag Aristoteles’ Denken heute noch so etwas wie Aktualität zu entfalten? Ganz bestimmt auf dem Feld des politischen Denkens, darin ist sich die Fachwelt einig. In seiner "Politik", einem der kanonischen Texte der abendländischen Staatstheorie, untersucht Aristoteles, ganz kritischer Empiriker, diverse Herrschaftsformen. Sein Resümee: Die Tyrannis ist das schlechteste aller Regierungssysteme. Diktaturen zerstörten das Vertrauen der Menschen zueinander und förderten das Spitzel- und Lauscherwesen, wodurch eine freie Diskussion unter Gleichen und Gleichberechtigten nicht zustande käme.
Herrschaft der "Tugendhaftesten"
Die Denker der europäischen Aufklärung konnten sich später ebenso auf Aristoteles berufen wie die Verfassungsväter der USA. Für den Tübinger Philosophen Otfried Höffe ist Aristoteles einer der wichtigsten Theoretiker republikanischen Denkens, zumal der große Grieche auch der reinen, direkten Demokratie eine Absage erteilt hat. "Da darf man nicht vergessen, was ,Demos‘ im Griechischen damals bedeutet hat: Das ist die ungebildete, arme Masse, bei der die Gefahr besteht, dass sie von Populisten, würden wir heute sagen, zu Dingen verführt wird wie zum Beispiel die Verurteilung des Sokrates, die mit dem Rechtsempfinden nicht zu vereinbaren sind."
Aristoteles plädierte für eine Mischform: einerseits Demokratie, andererseits Aristokratie, also die Herrschaft der Besten und "Tugendhaftesten". Anders gesagt: Er sprach sich für eine durch das Gesetz zivilisierte Demokratie aus, für Gewaltenteilung, wenn man so will. Die repräsentativen Demokratien, die das moderne Europa entwickelt hat, würden Aristoteles‘ Zustimmung finden, da ist sich Otfried Höffe sicher: "Dass wir beides haben - einmal Elemente von Demokratie, also dass die Macht vom Volke ausgeht, zum anderen, dass wir Abgeordnete wählen, von denen wir hoffen, dass sie sehr, sehr gut sind - das schafft eine gemischte Verfassung, wie es Aristoteles nennt und wie es durch Jahrhunderte nach seinem und auch anderer Denker Vorbild genannt wird."
Philosophie des guten Lebens
Mit den Göttern hatte Aristoteles nicht viel im Sinn. Und so erweist er sich auch auf dem Feld der praktischen Lebenskunst bis heute als fruchtbarer Denker. In der "Nikomachischen Ethik" entwickelt der Grieche eine Philosophie des guten Lebens, die gerade in einem postreligiösen Zeitalter wie dem unseren überraschende Aktualität entfaltet. Höchstes Ziel des menschlichen Lebens ist es in Aristoteles’ Augen, einen Zustand des Glücks zu erreichen, "eudaimonia" genannt. Diesen Glückszustand erlange man am besten durch die Kultivierung ethischer Tugenden, bei denen es jeweils das "rechte Maß" zu halten gelte.
Hellmut Flashar, klassischer Philologe an der Ruhr-Uni Bochum: "Das Maß ist für Aristoteles die Mitte. Damit ist nicht eine Mittelmäßigkeit gemeint, sondern das Maß, die Mitte, ist ein Höchstwert zwischen zwei Extremen. Die Tapferkeit definiert er zum Beispiel als Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Die Großzügigkeit ist für ihn die Mitte zwischen Geiz und Verschwendung."
Der Biologe
In der neueren Aristoteles-Forschung legt man das Augenmerk verstärkt auch auf den Biologen Aristoteles, wie Dorothea Frede hervorhebt, ein lange Zeit vernachlässigtes Gebiet der Aristoteles-Forschung. Denn auch auf dem Feld der Naturwissenschaften hat der 384 vor Christus geborene Denker Bahnbrechendes geleistet. "Zum Beispiel seine biologischen Forschungen, seine Einteilung in Tierarten - die Pflanzen hat er seinen Schülern überlassen -, das hat bis Linné Bestand gehabt. Das war wirklich ein Zweitausend-Jahre-Programm", so Frede.
2400 Jahre nach Aristoteles' Geburt ist man sich einig: Es gibt nur ganz, ganz wenige Philosophen in der Geschichte der Menschheit, die ähnlich einflussreich waren und sind wie der vielseitig begabte Arztsohn aus Thrakien. "Wenn wir das Muster eines Philosophen haben wollen", sagt Höffe, "dann bleibt Aristoteles neben zwei, drei anderen, die als Einzige dafür in Frage kommen."
Eigentlich könne nur Kant mit dem großen Griechen mithalten, was denkerische Originalität und philosophiegeschichtlichen Einfluss betrifft, meint Otfried Höffe. Als "göttlichen Aristoteles" feiert man den Philosophen seit der Spätantike. Das Bemerkenswerte daran ist: Der Meisterdenker aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert verdankt seinen Göttlichkeits-Status einem Denken, das zutiefst irdisch verwurzelt ist.