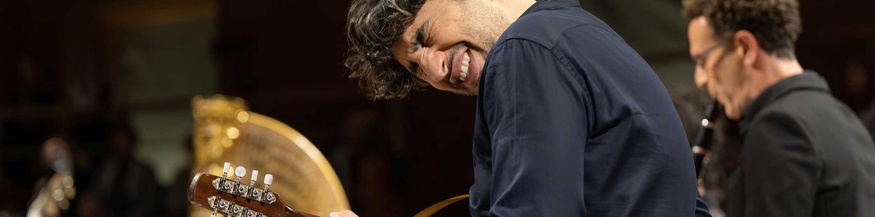Bibelessay zu Lukas 10, 38 - 42
Jesus ist zu Gast bei Maria und Marta. Die Schwestern begegnen an dieser Stelle im Lukasevangelium zum ersten Mal. Sie haben Jesus erst kennengelernt, nehmen den Fremden in ihrem Haus auf.
8. April 2017, 21:58
Erfüllte Zeit 17.7.2016
Genauer gesagt ist es Marta, die das tut. Sie ist die aktivere von beiden. Tätig sorgt sie für das Wohlbefinden des Gastes. Der Text nennt ihre Tätigkeit „wichtig“. Vermutlich folgt Marta den Regeln der Gastlichkeit: Sie sorgt dafür, dass Jesus sich von der Reise reinigen kann, bereitet Essen zu, bewirtet ihn. Was sie tut, wird als Diakonia beschrieben, als Liebesdienst.
Maria beteiligt sich nicht daran. Sie sitzt Jesus zu Füßen und hört ihm zu. Der griechische Text legt nahe, dass auch Marta dies tut. Gezeichnet ist damit eine idyllische, ja intime Szene: Die Frauen sind dem Fremden zugewandt. Sie sitzen bei ihm, hören zu. Es wird nicht gesagt, was geredet wird. Darauf scheint es in dem Moment nicht anzukommen. Wichtiger ist, dass diese Rede geschieht. Die Frauen vertrauen sich den Worten Jesu an, versuchen zu verstehen, sich in ihn einzufühlen.
Eine solche Einfühlung, die im Hören geschieht, hat Sigmund Freud eine Urform der Liebe genannt. Gelegentlich steht Marta auf und sorgt für den Gast. In den kleinen, damals üblichen Häusern muss sie dazu nicht aus dem Zimmer gehen, kann weiter zuhören. Auch die Tätigkeit, der Liebesdienst der Diakonia, ist eine Einfühlung. Marta versucht, sich in die Perspektive des Gastes zu versetzen, seine Bedürfnisse und Wünsche zu ergründen und sie zu erfüllen. Dieses Sich-Einfühlen in den Fremden lässt einen selbst nicht unverändert. Es bedeutet, im Hören, in der tätigen Sorge, die eigene Position aufzugeben, sich vom Gast in Anspruch nehmen zu lassen und dabei selbst anders, neu zu werden. Hören und Tun – beides scheint in der Erzählung nicht grundsätzlich verschieden.
Doch dann bricht die Szenerie. Marta hält inne. Plötzlich betrachtet sie die Szene quasi „von außen“. Und nun empfindet sie es als falsch, dass Maria ausschließlich zuhört. Man kann im Text ihren Ärger beinahe spüren, als sie Jesus fragt, ob er dies nicht auch falsch finde. Sie will, dass er Maria dazu bringt, ihr zu helfen. Jesus begegnet ihrem Unmut freundlich. Er spricht sie an, sagt zweimal ihren Namen. Und tadelt sie dennoch: „Du denkst und beunruhigst dich um vieles.“ Die Diagnose stimmt: Martas Kopf scheint zu schwirren. Sie macht Jesus Vorhaltungen. Sie fordert ihn auf, die Situation zu verändern. Und sie will, dass Maria ihr hilft. „Das ist“, so formuliert es der Bibelwissenschaftler Sebastian Schneider, „für die zwei Sätze, die sie spricht, eine ganze Menge, denn ihre Aufmerksamkeit ist damit auf dreierlei gerichtet: auf sich selbst, auf Jesus und auf Maria“.
„Eines nur“, so sagt Jesus zu Marta, „ist notwendig.“ Und dieses eine, gute, hat Maria gewählt. Die Einheitsübersetzung ist hier missverständlich. Der Text redet keineswegs vom Besseren. Es geht nicht darum, das bloße Hören der Maria gegen das Tun der Marta auszuspielen. Das eine, Notwendige – es ist das, was die Szene vorher so geprägt hat: sich dem Fremden zuzuwenden, sich im Hören und Tun auf Jesus einzulassen und dabei zu riskieren, sich selbst zu verändern.