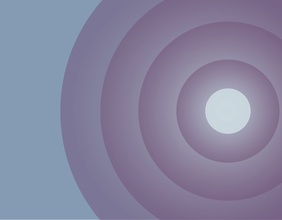Musikalische Vergangenheitsbewältigung
Von der schmerzhaften Aufarbeitung der NS-Zeit in der Musikwelt.
8. April 2017, 21:58

Das Salzburger Adventsingen geht auf die Initiative Tobi Reisers zurück.
APA/BARBARA GINDL
Intrada Exkurs führt in die Vergangenheit - nach Tirol, in die Steiermark und nach Salzburg. Wir greifen die Diskussionen um Josef Eduard Ploner und Sepp Tanzer auf, als Namensgeber für Preise, Straßen oder Musikschule. Wir gehen der Frage nach ob, Tobi Reiser ein adäquater Namenspatron für einen Preis oder ein Musikevent ist und nach welchen Kriterien der Joseph-Marx-Preis umbenannt wurde.
Langes Stillschweigen
Lange war die NS-Zeit kaum ein Thema für die Musikwissenschaft, lange waren die NS-Funktionäre respektierte Lehrer und Chorleiter, sie waren Uni-Rektoren und vielgelesene Autoren in Lehrbüchern. Lange war die Frage unterdrückt: Darf man diese Musik noch hören, spielen und verbreiten ohne sich nicht zumindest moralisch schuldig zu machen?
Die Frage sei, wie Geschichte organisiert werde, sagt Kurt Drexel, Musikwissenschaftler an der Uni Innsbruck über all jene Maßnahmen, die der Erinnerung und Verbreitung von Komponisten und Komponistinnen dienen, zum Beispiel Karl Senn: "Senn war Nationalsozialist, er stand im Ansehen der Zeit weit über Josef Eduard Ploner, als es aber nach 1945 eine Ploner-Gesellschaft gibt, werden die Werke wieder aufgeführt, Senn ist vergessen und der kleinere Ploner ist plötzlich präsent.
Antisemit und engagierter Lehrer
Die Beliebtheit des Tiroler Komponisten Josef Eduard Ploner wurde 2011 in Frage gestellt; damals kam eine CD mit Musik des ehemaligen "NS-Gau-Tonsetzers" Ploner heraus, das Beiheft der CD verschwieg jedoch völlig die biografischen Zusammenhänge des Komponisten mit der NS-Geschichte. Ploner arbeitete im Auftrag des NS-Gauleiters Hofer, er gab mit ihm gemeinsam ein Gau-Liederbuch heraus, widmete sein Werk den Nazi-Größen, verherrlichte den "Führer" in Liedern und Reden und vertonte zur Gewalt aufrufende Schmähgedichte auf das NS-Feindbild - wie "Judenbrut und Judengeld". Nicht zuletzt, weil die CD vom Land Tirol subventioniert wurde, erlangte die Frage für die breitere Öffentlichkeit Interesse. Zugleich mit der Diskussion über die NS-Vergangenheit wurden Argumente zur Verteidigung Ploners genannt. Auch Ploner hatte seine guten Seiten, sagt Drexel, in vielen Diskussionen erinnerten sich die Menschen positiv an Ploner, weil er ein engagierter Lehrer war.
Überzeugen, nicht verbieten
Kurt Drexel ist überzeugt, dass, "wenn jemand wie Sepp Tanzer Gaumusikleiter war, dann kann nach ihm keine Musikschule benannt werden. Ploner war fanatischer Antisemit und ein Rasseforscher, nach ihm sollte keine Straße benannt werden." Drexel will nichts verbieten und empfiehlt Zusatztafeln mit den Informationen, die die Musikwissenschaft liefere, "wenn dann die Betroffenen derart inkommodiert werden, dann können sie eine Änderung des Namens beantragen". Die Musikwissenschaft habe Verantwortung, den historischen Kontext darzulegen, findet Kurt Drexel, die Entscheidungen über den Umgang mit der Person fälle dann die Politik.
Und doch ist festzustellen: gerade diese Entscheidungen, eine Straße, eine Musikschule, einen Preis nicht mehr nach dem NS-Musikfunktionär zu nennen, fügen der Musikwelt besonderen Schmerz zu: es kommt regelmäßig zu einem Aufschrei. Eine ähnliche Geschichte wie jene von Josef Eduard Ploner ist die von Tobi Reiser, einem Salzburger Komponisten, der sich nach einer Karriere im "Dritten Reich" durch seine Gründung des Adventsingens in die Musikgeschichte eingeschrieben hat.
Tobi Reisers bruchlose Karriere
Elsbeth Wallnöfer, Volkskundlerin, hat mit ihrer Recherche 2013 die Geschichte der bruchlosen Karriere des Metzgermeisters Tobi Reiser in Österreich zum Thema gemacht. Emotional belegt ist auch der Name Tobi Reiser im Salzburger Musikleben. Bis vor kurzem war ein Preis für Volkskultur nach ihm benannt. Die Volkskundlerin Elsbeth Wallnöfer hat die Diskussion mit ihrer wissenschaftlichen Recherche in Gang gebracht. Sie wurde bedrängt, Akten herauszugeben und ihre Recherche einzustellen; erst 2016 wurde auf Grund einer Studie des Zeithistorikers Oliver Rathkolb Tobi Reiser aus dem Namen eines Preises herausgestrichen. Die Studie macht deutlich: Tobi Reiser, Mitbegründer des Salzburger Heimatwerkes, nützte seine privilegierte Stellung im NS-System, Volkskultur zu propagieren als Waffe gegen das, wie er es formulierte, "jüdische Gift"; alles war er tat - seine Liedtexte, seine Kulturfilme oder Konzertreisen - dienten der Kriegsmobilisierung und der Ausgrenzung jüdischer Menschen wie dem Trachtenverbot.
Für die Volkskundlerin Elsbeth Wallnöfer ist die enge und frühe Verbindung Tobi Reisers zum NS-System gravierend: Reiser hat bereits 1934 am Juli-Putsch der Nazis gegen die erste Republik teilgenommen. "Man kann nicht jemanden, der sogar gegen die Erste Republik geputscht hat, als großen Landespreisträger handeln." Tobi Reiser wurde nun als Namensgeber des Salzburger Kulturpreises abgesetzt, die Politik hat aus der Arbeit der Wissenschaft Konsequenzen gezogen.
Es geht auch anders
Das berühmte Salzburger Adventsingen, von Tobi Reiser als wenig geschmackvolles Weihespiel erfunden, behielt den Namen Tobi Reisers. Jedoch: die Maria-Anna-Mozart-Gesellschaft geleitet von der Sängerin und Musikologin Eva Neumayr, hat im vergangenen Advent zum zweiten Mal das Annette-Thoma-Adventsingen veranstaltet. Thoma, die 1974 fast 90 jährig gestorben war, sammelte, komponierte und textete Lieder und setzte sich für das Genre des geistlichen Volksliedes ein: Die Annette-Thoma-Advent-Tradition geht heuer ins dritte Jahr; eine der übersehenen, von der Musikgeschichte unterdrückten Komponistinnen wird so wieder sichtbar.
Mit der ungebrochenen Verehrung der Größen des "Dritten Reichs" werden deren Opfer übersehen: all jene, die ihre Posten verloren oder deren Verdienste bis heute zu gering geschätzt werden.
1989 wurde der steirische Joseph-Marx-Musikpreis umbenannt in Musikpreis des Landes Steiermark; die Joseph-Marx-Gesellschaft sprach daraufhin von einer skandalösen Verleumdungskampagne, ehemalige Schüler und Musikredakteurinnen setzten sich vehement aber schließlich erfolglos für eine Beibehaltung des Namens ein.
Auch den Komponisten und Musikfunktionär Joseph Marx betrifft, was Kurt Drexel eine Grauzone nennt: Einerseits den jüdischen Musikschriftsteller Ernst Decsey meidend, andererseits mit jüdischen Exilanten wie Eric Zeisl oder Erich Wolfgang Korngold in Briefkontakt; mit seiner Musik den Geschmack der NS-Funktionäre treffend, war Marx ein viel Geehrter in der NS-Ära, der in der Nachkriegszeit seine Karriere ehrenvoll fortführen durfte.
Wechselvolle Geschichte der Aufarbeitung
Die Geschichte der NS-Aufarbeitung in der Musikwissenschaft sieht Kurt Drexel in Wellen: in den 1960er Jahren hätte es den ersten großen Ansatz gegeben, die Musikwissenschaft, "die ja sehr braun war" aufzuarbeiten, nicht nur berühmte Namen in Frage zustellen. Danach sei wieder ein Biedermeier in der NS-Aufarbeitung eingetreten, und ab den 2010er Jahren komme, so Drexel, eine Epoche, "wo man genauer ins Detail sieht und an die Ränder, in die Provinzen". Die Musikwissenschaft trete nun in eine Phase ein, in der sie die Musik in den vom "Deutschen Reich" besetzten Gebieten untersuche, die subtile Unterwanderung mit den Ideologien von der "Vorherrschaft der deutschen Musik."
Die Forderung Elsbeth Wallnöfers an die universitäre Wissenschaft geht über Erforschung und Veröffentlichung der NS-Untaten hinaus; eine wissenschaftliche Evaluierung, so ist sie ganz sicher, muss auch die musikalische oder musikpädagogische Qualität erfassen. Nach der Hackbrett-Schule des Tobi Reiser wird noch heute unterrichtet. "Wir sind erst am Anfang", erkennt auch Kurt Drexel, "wie´s weiter geht , wissen wir nicht."