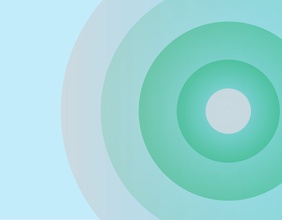APA/KEYSTONE/PETER KLAUNZER
Dimensionen
Das bedingungslose Grundeinkommen
In der Schweiz wurde bereits darüber abgestimmt, in Finnland wird es derzeit getestet und in Deutschland wurde es schon 85 Mal verlost: die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens begeistert viele. Die Motive dahinter sind allerdings vielfältig.
9. Juni 2017, 02:00

Schweiz, 2016: Demonstranten halten Plakate mit Umfrageergebnissen hoch, während einer Aktion zum Start der Abstimmungskampagne für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
APA/KEYSTONE/PETER KLAUNZER
Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sehen in ihm einen Ausweg aus prekären Arbeitsverhältnissen und eine Antwort auf die zunehmende Automatisierung. Das Grundeinkommen befreie Menschen von ihrer finanziellen Existenzangst und dem damit einhergehenden Stress.
Kritiker hingegen bezeichnen das bedingungslose Grundeinkommen als nicht finanzierbare Utopie. Eine Utopie, die desaströse Auswirkungen habe könnte. Denn Menschen würden durch das Grundeinkommen nicht mehr arbeiten, sondern sich in die vielzitierte soziale Hängematte legen.
7 Tage Ö1
Dimensionen (bis 17. Mai)
Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sieht vor, dass jede Bürgerin, jeder Bürger ein staatlich finanziertes Einkommen erhält, das existenzsichernd ist. Oft ist von 1.000 Euro monatlich die Rede. Das Grundeinkommen wird bedingungslos ausgezahlt. Es ist an keine Kriterien geknüpft und es müssen keine Gegenleistungen erbracht werden. Im Gegenzug entfallen staatliche Transferleistungen wie Kindergeld, Arbeitslosengeld oder die Mindestsicherung.
"Die Menschen hätten ein existenzsicherndes Grundeinkommen, ohne das sie gezwungen sind jede Art von Arbeit annehmen zu müssen. Vielleicht mit der Freiheit neue Formen der Arbeit zu schaffen", sagt Margit Appel, Politologin an der Katholischen Sozialakademie.
Zwischen Sozialromantik und Neoliberalismus
Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens hat quer durch alle politischen Lager Unterstützer wie Gegner. Linke Befürworter sehen in ihm das Potenzial Menschen von der entfremdeten Arbeit zu befreien. Es wäre nicht nur ein radikales Konzept zur Armutsbekämpfung, sondern würde auch eine andere Gesellschaft etablieren. Eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder nicht anhand von Leistung beurteilt, sondern eine gerechte Verteilung vorsieht. Menschen sollen sich selbst verwirklichen können ohne sich ständig um ihre Existenz sorgen zu müssen.
Auch unter liberalen Unternehmern stößt das bedingungslose Grundeinkommen auf Zustimmung. Werner Götz, der Gründer der Drogeriemarktkette DM, plädiert seit Jahren für ein solches Grundeinkommen. Unterstützt wird seine Forderung auch von Siemens-Chef Joe Kaeser. Das Grundeinkommen könnte ihrer Ansicht nach eine Antwort auf die fortschreitende Automatisierung von Arbeit sein.
In Finnland wird bereits mit dem bedingungslosen Grundeinkommen experimentiert. 2.000 zufällig ausgewählte Arbeitslose bekommen anstatt des Arbeitslosengeldes 560€ monatlich. Das Geld wird bedingungslos überwiesen, egal ob die Person einen Job annimmt oder nicht. Dabei geht es der liberal-konservativen Regierung weniger um die persönliche Verwirklichung der Testpersonen, sondern vielmehr um eine Vereinfachung des Sozialsystems. Man wolle vor allem die Bürokratie verringern und Einsparungspotenziale identifizieren, sagt Marjukka Turunen von der finnischen Sozialversicherungsanstalt Kela.
Finanzierung und Auswirkungen
Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde in Österreich ungefähr 100 Milliarden Euro jährlich kosten. Das entspricht fast einem Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Wie sich ein Grundeinkommen auf den Arbeitsmarkt auswirken würde, ist eine der offenen Fragen. Florian Wakolbinger vom freifinanzierten Forschungsinstitut "Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung" geht davon aus, dass viele ihr Stundenausmaß reduzieren würden. Die Beteiligung an der Erwerbsarbeit würde aber nicht maßgeblich zurückgehen. Allerdings könnte sich die Entlohnung von Arbeit maßgeblich verändern.
"Ich würde erwarten, dass die Löhne für mühselige Arbeiten deutlich steigen müssten, während die Löhne für angenehme Arbeiten sinken könnten", sagt Florian Wakolbinger, Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung.
Die verschiedenen Sichtweisen auf das Grundeinkommen spiegeln sich auch in den Finanzierungskonzepten wider. Linke Finanzierungsmodelle sehen eine Umverteilung von oben nach unten vor. Das Grundeinkommen könnte durch eine höhere Besteuerung von Kapital und Ressourcen ermöglicht werden. Wohingegen Liberale das Grundeinkommen gerne über eine flat tax, also einen einheitlichen Steuersatz, oder über die Anhebung der Mehrwertsteuer auf 50 Prozent finanzieren würden.