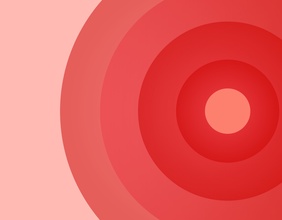APA/AFP/KAREN MINASYAN
Du holde Kunst
Die Armenien-Reise des Ossip Mandelstam
Im Rahmen der Schwerpunktwoche zu Armenien stellt die Ö1 Reihe "Du holde Kunst" den bedrängten Dichter des Akmeismus und seine Begegnung mit dem Land "der ersten und ältesten Menschen" in den Mittelpunkt.
3. August 2017, 15:16
Ossip Mandelstam bereiste in Begleitung seiner Frau Nadeschda Abchasien, Georgien und Armenien von April bis November 1930. Diese Reise gehört zur glücklichsten Phase im schwierigen Leben des russischen Lyrikers, das im Dezember 1938 in einem Lager in der Nähe von Wladiwostok endete. Sie bedeutet eine Auszeit von der 1928 einsetzenden Hetzkampagne gegen den Dichter.
Ermöglicht worden war Mandelstam diese Reise von Nikolaj Bucharin, dem einzigen höhergestellten Parteifunktionär, der nicht sein Feind war und der die Qualität seiner Dichtung erkannte. Bucharin sollte wenig später selbst zum Opfer von Stalins "Säuberungen" werden. Er wurde 1938 nach einem Schauprozess erschossen.
Die Gedichte kommen zurück
"Die Reise nach Armenien war … vielleicht einer der tiefsten Ströme in Mandelstams historiosophischem Bewusstsein… Die kulturelle Tradition war für Mandelstam nie unterbrochen: die europäische Welt und das europäische Denken wurden im Mittelmeerraum geboren – dort begann jene Geschichte, in der er lebte, und jene Poesie, in der er aufgehoben war. Die Kulturen des Kaukasus-Schwarzmeerraums waren ebenjenes Buch, "aus dem die ersten Menschen lernten"… Für Mandelstam war die Ankunft in Armenien die Rückkehr in einen vertrauten Schoß, dorthin, wo alles angefangen hatte, zu den Vätern, zu den Quellen, zum Ursprung. Nach langem Schweigen kamen die Gedichte in Armenien zu ihm zurück und verließen ihn nie mehr…"
(Nadeschda Mandelstam)
Elementar statt revolutionär
Das literarische Ergebnis dieser Reise waren ein Gedichtzyklus, ein Prosatext und ein Notizbuch. Der Prosatext "Die Reise nach Armenien" erschien 1933 in der Leningrader Literaturzeitschrift Swesda und wurde zum politischen Skandal. Er sollte zur letzten Publikation Mandelstams zu seinen Lebzeiten werden. Denn was von Mandelstam erwartet wird, erfüllt er nicht. Statt den revolutionären Fortschritt im Armenien unter Stalin zu preisen, Traktoren und Staudämme zu besingen, spürt er dem Elementaren nach: dem Licht, der Erde, den Farben.
Die ersten Menschen nach der Sintflut
Armenien war für den Juden Mandelstam Sehnsuchtserde, die "jüngere Schwester der judäischen", biblisches Land. Am Ararat legt die Arche Noahs an, die Armenier sehen sich selbst als die ersten Menschen nach der Sintflut. Ein Stück Europa "am Rande der Welt" bedeutet ihm dieser östliche Vorposten jüdisch-christlicher, europäisch-abendländischer Kultur. Dieser trifft hier auf den Orient, dessen Poesie ebenfalls aufgespürt wird – es finden sich zahlreiche persische Motive in Mandelstams Gedichten.
Mitten in der stalinistischen Gleichschaltung der Literatur, nimmt Mandelstam Bezug auf einen Urraum der Zivilisation, sucht nicht den neuen Menschen, sondern den alten, die Wurzeln seiner Kultur. Er setzt der "Kürbisleere" Russlands die "Lebensfülle" Armeniens, dem halbtoten Sowjetmenschen die "wilden Kinder" des Kaukasus entgegen.
Verzweifelte Selbstbehauptung
Und es gibt noch eine zweite Ebene, die die Früchte dieser Reise zum Skandal macht: dem verfolgten Dichter entgeht nicht die Gemeinsamkeit zwischen seinem Schicksal und dem eines Volkes, das Unterdrückung, Vertreibung, Mord erleidet. Er solidarisiert sich mit ihm. Auch in dessen verzweifelter wie unnachgiebiger Selbstbehauptung findet sich eine Parallele zu Mandelstams Umgang mit seiner Zeit.
Die Armenien-Gedichte Mandelstams sind durchdrungen von einer hellwachen Sinnlichkeit. Doch ihre Vitalität jubelt spürbar in Todesnähe.
Service
Ossip Mandelstam, "Armenien, Armenien!", Prosa, Notizbuch, Gedichte 1930-1933. Aus dem Russischen übertragen und herausgegeben von Ralph Dutli.