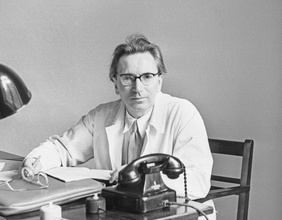APA/HERBERT PFARRHOFER
Roman von Leonhard Hieronymi
In zwangloser Gesellschaft
Leonhard Hieronymi nimmt den Leser auf eine Gräbertour: In seinem Roman "In zwangloser Gesellschaft" gibt der 1987 in Bad Homburg geborene Autor, Publizist und Verfasser des umstrittenen Manifests "Ultraromantik", "seinen" Unsterblichen der Literaturgeschichte Raum und Lebendigkeit.
4. November 2020, 02:00
Ex libris | 04 10 2020
Auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main befindet sich das Grab von Robert Gernhardt, Dichter, Zeichner und Karikaturist mit unnachahmlichem Humor. Gernhardt starb 2006, nach Jahren der Krankheit, mit 68 Jahren. Jetzt liegt er da, wo auch Schopenhauer und Adorno, Marcel Reich-Ranicki und Ricarda Huch bestattet sind.
Sendung hören
Radiogeschichten | 05 10 2020
"Ex libris"-Podcast
In dem wöchentlichen Podcast wird Peter Zimmermann jeweils ein Buch aus der aktuellen Sendung auswählen und als Buchtipp der Woche vorstellen, manchmal auch in einem Gespräch. Ö1 Podcast abonnieren
Aber "Gernhardt war mir der Wichtigste", sagt der Erzähler in Leonhard Hieronymis Roman "In zwangloser Gesellschaft". Um ihn machte er sich "die meisten Sorgen" - dass er nämlich in Vergessenheit geraten und seine Bücher nicht mehr gelesen werden könnten. "Vielleicht", erklärt er, vielleicht "ist es der ewige Fluch derjenigen Literatur, die Ernst und Spaß miteinander verbinden will, die Gernhardt vom großen Weltruhm bis heute fernhält. In diesem Land scheitert diese Literatur ja immer."
Vor dem Vergessen bewahren
Mit dem Besuch bei Robert Gernhardts letzter Ruhestätte beginnt Leonhard Hieronymis Erzähler im Sommer 2018 seine einjährige Reise zu den Gräbern von Schriftstellern und Schriftstellerinnen, manche sind noch immer berühmt, die meisten aber drohen vergessen zu werden - oder sind es längst.
"Bei vielen war es mir wichtig, sie vor dem Verschwinden zu bewahren, zumindest mit dem vollendeten Buch", sagt der Autor dieses stark autobiografischen Romans, Leonhard Hieronymi, der in den letzten Jahren ein Faible für Friedhöfe entwickelte. "Wenn man in fremden Städten war, ist man automatisch zum Friedhof gegangen und konnte da erstens Ruhe suchen und zweitens kurz auf Wikipedia schauen, wer da begraben liegt."
Störung der Totenruhe
Hieronymis Gräbertour ist kein schwermütiger Gang hinab ins Totenreich, keine düster-melancholische Memento-Mori-Klage. Sie ist eine wilde Abenteuerreise, mit vielen Zitaten und Anekdoten im Gepäck, komisch, skurril und manchmal auch ein bisschen albern.
Sie beginnt mit einem "Vorspiel". Vor Jahren, als er bei einem Rom-Besuch sich einer Führung durch die Kallistus-Katakomben anschloss, überkam den Erzähler ein jäher Lachanfall - eine Störung der Totenruhe, für die er sich zehn Jahre später entschuldigen will, denn seine Reise zu europäischen Friedhöfen soll in der Ewigen Stadt enden. Er musste in den vergangenen Jahren "zwar nicht über den Tod, aber häufig über die Gegensätze von Verschwinden und Unsterblichkeit nachdenken".
Moos und vertrocknete Rosen
"Vor allem bei halb oder komplett vergessenen Schriftstellern wollte ich sehen, wie sieht das Grab aus, nachdem sie auch kaum noch gelesen werden?", sagt sagt Leonhard Hieronymi. "Wie sieht das Grab von Jörg Fauser aus in München? Wird es gepflegt - oder was passiert da? Da musste man auch erstmal alte Karteikästen durchsuchen, um mir zu zeigen, wo der liegt."
Jörg Fauser, eine Art Charles Bukowski der deutschen Literatur, starb 1987, in der Nacht nach seinem 43. Geburtstag. Er war zu Fuß auf der Autobahn unterwegs, als ihn ein Lastwagen überrollte. Sein Grab auf dem Münchner Ostfriedhof ist bedeckt von Moos und vertrockneten Rosen. Hat der Fauser-Fan anderes erwartet? Er verrät es nicht, eilt weiter zum nächsten Münchner Friedhof, erzählt eine Anekdote über Rainer Werner Fassbinder und telefoniert mit einem Totengräber. So bleibt vieles angerissen, kursorisch, sprunghaft.
Rom, Grinzing oder Prag
In Hamburg besucht der Erzähler das Grab von Hans Henny Jahnn, dem "geheimnisvollsten Schriftsteller Deutschlands", der sich auch als Pferdezüchter, Orgelbauer und Hormonforscher versuchte und glaubte, "dass die Seele im Körper verweilte und dass in ihr Erinnerungen gespeichert wurden"; in Bad Oldesloe das Grab von Heino Jaeger, einem genialen Satiriker, der seine letzten Jahre in psychiatrischen Anstalten verdämmerte; in Rom zieht es ihn zu Shelly, Keats und Bud Spencer, der, da er Kochbücher verfasste, auch ein Autor war. Auf dem Grinzinger Friedhof glaubt er Thomas Bernhard zu begegnen.
Nicht immer sind die Reisen von Erfolg gekrönt. Der jüdische Friedhof in Prag hat am Schabbat geschlossen, so ist Kafkas Grab nur durch einen Mauerspalt zu erspähen. Das Grab von Ovid, das sich mutmaßlich an seinem Verbannungsort am Schwarzen Meer befindet, bleibt ebenso unauffindbar wie das von Karl-Herbert Scheer, einem Science-Fiction-Autor, der die ersten Heftchen der "Perry Rhodan"-Serie schrieb und über den "Zellaktivator" und die "relative Unsterblichkeit" phantasierte.
Die großen Fragen
Ist das ist alles - ein Buch als schlichte Folge mehr oder weniger origineller Episoden über Tote und Untote, über gefundene und verpasste Gräber, über Friedhöfe in verschiedenen Jahreszeiten? Nein, es geht auch, zumindest andeutungsweise, um die "großen Fragen": Was kommt nach dem Tod? Gibt es etwas, das unsterblich ist? Friedrich Nietzsche wird zitiert, er prägte die Formel von der "ewigen Wiederkunft", der zufolge sich Ereignisse unendlich oft wiederholen. "Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht", glaubte Nietzsche. Harry Rowohlt sekundiert, wenn er sagt: "Nichts geht verloren, fast jeder Kreis schließt sich."
Ganz anders Arno Schmidt, der in seiner Erzählung "Tina oder Über die Unsterblichkeit" die Vorstellung von einem Dichter-Elysium entwickelte, einem Zwischenreich, aus dem der Autor erst befreit wäre, wenn niemand ihn mehr kennen würde. Vergänglichkeit gilt hier als Segen.
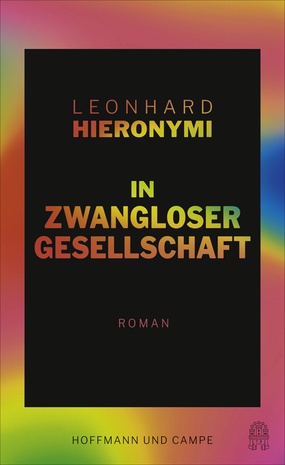
HOFFMANN UND CAMPE
"Viele Erzählungen sollen unfertig wirken"
Leonhard Hieronymis Erinnerungsarbeit bleibt halbherzig. Seine Reisebeschreibungen haben schöne schräge Momente, die Ausführungen zu Leben, Werk und Gräbern von Dichtern aber wirken oft brav, bleiben knapp und bruchstückhaft.
"Viele Erzählungen, viele Kapitel wirken unfertig und sollen aber auch unfertig wirken", sagt der Autor. "Ich bin reingeschmissen worden und rausgeschmissen worden während des Schreibens, hab dann auch oft gedacht, so, jetzt reicht’s. Das ist natürlich auch die Poetik der Verschwendung, so könnte man es nennen. (...) Und es ist das Schnelle vor allem, das ich damit beabsichtigt habe. Ich glaube, man liest es auch schnell. Man fragt sich, ja gut, jetzt hätte er auch ein bisschen ausführen können, aber warum nicht. Gehe ich halt selbst auf den Friedhof."
"Ultraromantisch"?
Großmäuligkeit und Witz, Reise- und Abenteuerlust und tiefe Müdigkeit, das Fahrige und das Pointierte: In diesem Roman steht das nebeneinander. Aber ist er deshalb "ultraromantisch"? "Ultraromantik" war ja das, was Hieronymi in einem provokanten Manifest der deutschen Literatur verordnete, als Gegenmittel zum bräsigen Erzählen. "Ultraromantik", das zielt auf die Verbindung von Romantik mit Science-Fiction und versteht sich als "Appell für mehr Lebendigkeit, Action, Poesie, Fun und Wagnisse". Kann der Roman das einlösen?
Hieronymi: "Nein, er löst nicht die Zusammenlegung der Science-Fiction mit dem Motiv des Romantischen ein. Das hat er nicht getan, dafür ist er zu gegenwärtig. Aber er löst wahrscheinlich mehrere andere Dinge ein, die in der ‚Ultraromantik‘ vorkommen, und zwar wirklich auch die Geschwindigkeit oder den Mut, Fehler zu begehen, nicht zu viel nachzudenken, auch was den Schreibakt angeht. Die Pointen, die ins Leere gehen oder die Reisen, die ins Leere gehen. Und überhaupt viele Leerstellen, egal, ob man im Kreis geht oder verschwindet am Ende."
Am Schluss wird der Erzähler zwar wieder nach Rom gelangen, nicht aber zu den Kallistus-Katakomben, offenbar hat er unterwegs die Lust dazu verloren. Kein Kreis schließt sich. Die Reise endet, und das Ende bleibt offen.
Leonhard Hieronymi, "In zwangloser Gesellschaft", Roman, Hoffmann & Campe