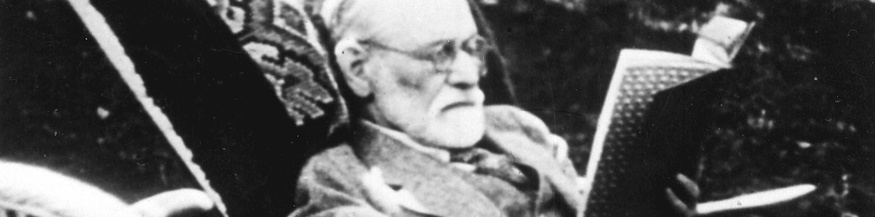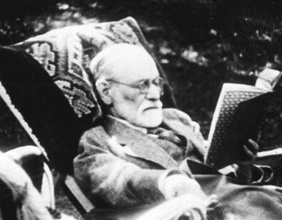STYRIA VERLAG
Diagonal
Wildnis? Welche Wildnis?
Born to be wild. Für wen gilt das heute noch? Für die gemeine Mitteleuropäerin eher nicht. Versichert und abgesichert von der Krippe bis zur Bahre.
16. November 2021, 12:00
Der Lebensweg vorgegeben: Kindergarten, Schule, Ausbildung, Arbeit, Pension, Friedhof. Sicherheit als oberstes Gut einer Hochtechnologie-Gesellschaft, die sich jeden Schritt vom GPS vorgeben lässt. Auch im freizeitlichen Abenteuer. Die Maschen im Netz sind eng, wir haben es gern mess- und kontrollierbar. Das Gros der Gesellschaft hat Angst vor dem Wilden.
Es gibt aber auch die Verwegenen, die mit dieser Lebensart keine Luft bekommen und sich auf das Unbekannte, Unregistrierte, Unvorgelebte einlassen. Sie ziehen als Anthropologen oder Geologinnen, Wildbiologinnen oder Jäger, Schriftstellerinnen oder Journalisten oder einfach Aussteiger/innen in den fernen Urwald, ins Hochgebirge, in die Wüste oder Steppe und versuchen, mit dem zurechtzukommen, was da ist - wenn da noch etwas ist, an Wildnis. Denn fast alle Landschaften auf der Erde sind mittlerweile Kulturlandschaften, in die der Mensch großräumig eingegriffen hat. Die echte Wildnis ist rar. Und außerdem, was ist schon "echte" Wildnis?
Schärfen der Sinne
Für die Menschen, die in der "Wildnis" leben, wie wir Industrialisierten sie definieren, ist daran nämlich nichts wild. "Wir sahen das weite offene Flachland, die schönen, sanft geschwungenen Hügel, die sich schlängelnden Bäche mit verworrenem Bewuchs nicht als wild", sagte etwa Luther Standing Bear vom Oglala-Lakota-Sioux-Volk. "Für uns war es zahm. Nur für weiße Menschen war Natur Wildnis." Weil sie die Gegend nicht lesen konnten, nicht alphabetisiert waren im Wald- oder Steppenleben …
Also was jetzt? Gibt es das Wilde überhaupt? Die junge französische Anthropologin Nastassja Martin meint: Ja! Sie regt mit ihrem Buch "An das Wilde glauben" sogar dazu an, sich darauf einzulassen, obwohl sie in den Wäldern Kamtschatkas bei ihren Feldforschungen ihr halbes Gesicht an einen Bären verloren hat. Sie sieht in der Auseinandersetzung mit dem "Wilden" die Möglichkeit, das andere im Eigenen zu entdecken, erlernte Grenzen zwischen Mensch und Natur wieder zum Verschwinden zu bringen und sich zu schulen in einem weiteren und tieferen Blick.
Verheißung vom "richtigen Leben"
Lang war die Wildnis in unserer Kultur eine romantische Idee, ein Sehnsuchtsort von unverschmutzter natürlicher Schönheit - möglichst ohne Menschen. Gegenentwurf zum reglementierten Stadtleben, spirituelle Erkenntniszone zum Reinigen des Geistes, zum Wiederanknüpfen an den Ursprung, an die Verbundenheit von Mensch und Natur.
Oder sie bot eine Möglichkeit, seine Grenzen zu spüren, sich lebendig zu fühlen, wie der junge zivilisationsmüde Aussteiger Chris McCandless, 1992 an Hunger gestorben in der Wildnis Alaskas, in die er, ausgestattet mit einer Schusswaffe und einem Fünf-Kilo-Sack Reis, aufgebrochen war.
Wildnis wieder einrichten
"Was ich wünschte, war Bewegung, und nicht ein ruhiges Dahinfließen des Lebens. Es verlangte mich nach Aufregungen und Gefahren, nach Selbstaufopferung um eines Gefühls willen. In mir war ein Überschuss von Kraft, der in unserem stillen Leben keinen Raum zur Bestätigung fand." Diese Zeilen von Leo Tolstoi fand man neben der Leiche des jungen Mannes im Wald. Eine Verlockung. Eine Verheißung vom "richtigen Leben" außerhalb des normierten gesellschaftlichen Daseins, in Weltgegenden, die nicht zu Tode genutzt, geformt und ausgebeutet worden sind.
Was aber tun, wenn die Wildnisgebiete rar werden? Sie wieder einrichten, schlägt der britische Zoologe und Autor George Monbiot vor. Gebiete - auch im dicht besiedelten Europa -, die nicht für die Landwirtschaft gebraucht werden, rückverwildern, um nicht nur unsere Ökosysteme wieder reicher werden zu lassen, sondern auch unser Leben. Eine verheißungsvolle Idee.
Gestaltung
- Ines Mitterer