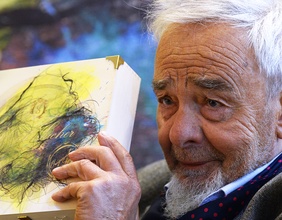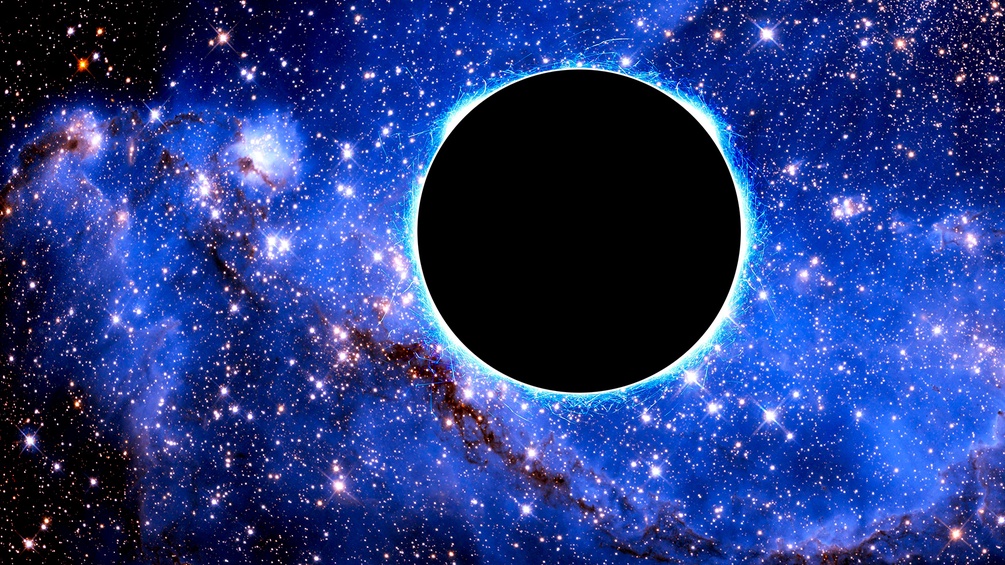
AP/VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Dimensionen
Im Schlund des Schwarzen Lochs
Ihre gewaltige Schwerkraft verschlingt alles, was in ihren Einflussbereich gerät. Selbst Licht bleibt in ihnen gefangen, sofern es einmal in ihr Inneres gezerrt wurde. Als Gegenstände der theoretischen Astrophysik sind Schwarze Löcher längst etabliert. Doch was die direkte Kontaktaufnahme via Messung betrifft, halten sich die Erkenntnisse bisher in Grenzen. Das erste Foto eines Schwarzen Loches gelang Wissenschafter:innen erst im Jahr 2019.
15. Juli 2022, 02:00
Ein dunkler Fleck und ein verschwommener orange-roter Ring. Dieses Ding sieht aus wie ein mäßig gelungener Donut, der von einem mäßig begabten Fotografen abgelichtet wurde. Zumindest würde niemand vermuten, dass es sich hierbei um eine der spektakulärsten Aufnahmen handelt, die in der Wissenschaft jemals angefertigt wurden. Doch genauso verhält es sich: Die hier beschriebene Aufnahme, veröffentlicht im April 2019, ist der erste Beleg dafür, dass man Schwarze Löcher direkt mit Teleskopen beobachten kann.

NASA/EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION
Nicht, dass es in der Forschergemeinde große Zweifel daran gegeben hätte, dass Schwarze Löcher tatsächlich existieren. Dafür war das Netz an indirekten Nachweisen - von Gravitationslinsen bis hin zu Gezeitenkräften in Sternen - zu eng geknüpft. Aber es macht einen Unterscheid, ob der Nachweis mit unseren Sinnen nicht zugänglichen Methoden gelingt, oder eben auf eine Art und Weise, die man im weitesten Sinne auch als „Sehen“ bezeichnen könnte.
Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren
Das Foto jedenfalls können wir sehen. Freilich: Auch dabei handelt es sich um eine aufwendige Rekonstruktion, die auf Quintillionen von Messdaten beruht. Wenn wir von „Sehen“ sprechen, dann sollte uns klar sein, dass es sich um sekundäres, durch Supercomputer errechnetes Sehen handelt.
Gleichwohl ist das Ergebnis von einer unbestreitbaren sinnlichen Überzeugungskraft. Der dunkle Fleck im Inneren des orange-roten Rings nämlich ist tatsächlich das, was Physiker:innen bisher zwar berechnen, aber eben nicht sinnlich fassen konnten. Jene „Ereignishorizont“ genannte Grenzschicht, hinter der alles aus dieser Welt entschwindet und für immer und ewig im Inneren des Schwarzen Loches gefangen bleibt. Also im Grunde die Sichtbarmachung des Unsichtbaren.

APA/AFP/NASA/HO
Die Hawking-Strahlung
An dieser Stelle ist eine kleine Korrektur angebracht. Die Sache mit dem „immer und ewig“ ist ein bisschen umstritten. Mitte der 1970er Jahre überprüfte der britische Physiker Stephen Hawking die Idee, dass es an der Grenzschicht von Schwarzen Löchern zu Quanteneffekten kommen könnte. Seine Berechnungen legen nahe: So etwas ist möglich, Schwarze Löcher mögen zwar durch ihre unbändige Schwerkraft alles verschlucken, was in ihre Nähe kommt (selbst Licht!). Doch durch Fluktuationen im Vakuum senden sie auch ein klein wenig Strahlung aus. Und nach langer, langer, langer Zeit sollten sie dadurch sogar „verdampfen“.
Experimentell nachgewiesen wurde die Hawking-Strahlung allerdings nicht - und wird es wohl auch nicht werden. Dafür sind die Effekte zu winzig und Schwarze Löcher eindeutig zu weit entfernt. Selbst der Favorit für das nächstgelegene Schwarze Loch im auf der Südhalbkugel gelegenen Sternsystem HR 6819 befindet sich mit 1.000 Lichtjahren Entfernung jenseits aller messtechnischen Möglichkeiten. Bleibt die Hawking-Strahlung ein reines Theorie-Konzept, ohne jede Chance auf direkten Nachweis?
Ein Badewannen-Modell eines Schwarzen Lochs
Anfang der 1980er Jahre hatte der kanadische Physiker William Unruh eine ziemlich verrückte Idee. Die Hawking-Strahlung, dachte er sich, mag zwar unerreichbar sein. Aber was wäre, wenn man sich stattdessen einfache Systeme ansieht, die auch eine Art Ereignishorizont besitzen? So ein akustisches Analogie-Modell könnten zum Beispiel Schallwellen in einem extrem schnell (mit Schallgeschwindigkeit) fließenden Wasserfall sein, argumentierte Unruh. Könnte man so ein Badewannen-Modell eines Schwarzen Lochs im Labor herstellen? Und könnte man damit etwas über die echten Schwarzen Löcher da draußen im Universum erfahren? Vor einigen Jahren gelang Unruh mit seiner deutschen Kollegin Silke Weinfurtner ein spektakuläres Experiment, das genau diesen Schluss nahelegt.
Gestaltung
- Robert Czepel