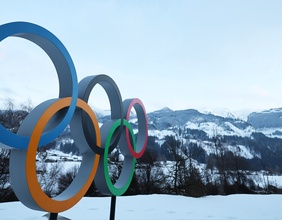Medienmacher Ernst Tradinik: Inklusive Medien basieren auf Augenhöhe
4. April 2025, 15:30
FreakCasters - Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast geht es um Menschen, Geschichten und Leidenschaften. Heute stellen wir euch Ernst Tradinik vor. Seine Leidenschaft ist seit mehr als 25 Jahren die inklusive Medienarbeit. Und dazu hat er Ende 2024 im Herbert von Halem Verlag ein Buch herausgegeben mit dem Titel „Inklusive Medienarbeit - Menschen mit Behinderung in Journalismus, Radio, Moderation und Film“. Tradinik hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaften studiert und über 30 Jahre in betreuten WGs gearbeitet. 2019 gründete er sein Unternehmen „Menschen und Medien“. Neben seiner Arbeit im Bereich der inklusiven Medienproduktion begleitet er Menschen als Supervisor und Coach. Außerdem hat er inklusive Medienarbeit an der Fachhochschule Sankt Pölten unterrichtet. Christoph Dirnbacher und ich haben Ernst Tradinik eingeladen, um über sein neues Buch zu sprechen, das inklusive Medien in Österreich, Deutschland und der Schweiz beleuchtet.
Christoph Dirnbacher:
Am Beginn des heutigen Gesprächs bei FreakCasters würde ich dich gerne fragen: Ernst, du bist Trainer, du bist Behindertenbetreuer, du bist Medienmacher. Welche Rolle spielt das Radio in deinem Leben?
Ernst Tradinik:
Radio hat lange eine ganz große Rolle gespielt, weil wir haben ja lange „Radio Insieme – die Sendung für Menschen mit Herz und anderen Störungen“ gemacht. Beim Freien Radio in Wien, das muss ich jetzt gleich anbringen. Und das haben wir wöchentlich gemacht, neben der Arbeit als Betreuer in der 1. Psychiatrie-Auslieferungs-Wohngemeinschaft in Wien, im Downtown vom 18. Bezirk. Jetzt als Supervisor bin ich tätig. Und Radio ist es noch, wenn ich das in der intensiven Medienarbeit umsetze.
Sandra Knopp:
Radio Insieme war eine wöchentliche Radiosendung in Wien, die zwölf Jahre auf dem Community-Radiosender Orange 94.0 ausgestrahlt wurde. Ernst Tradinik und sein Kollege Ronald Strasser moderierten. Das Motto lautete: die Sendung für Menschen mit Herz und anderen Störungen. Dabei sprachen sie über die Arbeit und den Alltag mit Menschen mit Lernbehinderung oder psychischer Erkrankung, die sie damals betreuten. Diese waren von der Psychiatrie Steinhof in eine betreute WG gezogen. Gesprochen wurde über berufliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Und die damaligen Bewohner und Bewohnerinnen kamen via Jingles in der Radiosendung zu Wort.
Christoph Dirnbacher:
Zwölf Jahre hat es die Sendung gegeben. Was fasziniert dich am Medium Radio?
Ernst Tradinik:
Ich weiß nicht, ich bin irgendwann spät draufgekommen, dass ich das als Kind schon gemacht habe. Mein Vater hat ein altes Tonband gehabt und ein Mikrofon. Und irgendwann habe ich als Kind begonnen, Sendungen zu machen. Ich glaube, das ist dieses Sprechen ins Mikrofon. Und es ist eigentlich sehr abstrakt. Also wenn man nicht so wie jetzt gegenübersitzt, sitzt du allein im Studio und sprichst zu Personen, die du gar nicht siehst oder kennst. Du weißt gar nicht, ob da jemand zuhört. Manchmal weiß man es. Ich glaube, die Kombination von Stimme und Musik ist es.
Sandra Knopp:
In seinem Buch hat Ernst Tradinik inklusive Medienarbeit so beschrieben: Zitat: „Inklusive Medienarbeit meint die elektronische Medienarbeit. Dazu zählt Radio, Video oder ähnliches. Medienarbeit von und mit Menschen mit Behinderung, Lernbehinderung oder psychischer Erkrankung. Mit und ohne Unterstützung von Experten und Expertinnen aus dem sozialpädagogischen, kommunikationswissenschaftlichen oder ähnlichen Bereichen.“ Zitat Ende.
Christoph Dirnbacher:
Gibt es etwas, das man, wenn man Seminare gibt oder wenn man Teilnehmer hat, die beispielsweise Lernschwierigkeiten oder auch psychische Erkrankungen haben, gibt es etwas, das man beachten soll, abgesehen von einer Arbeit auf Augenhöhe?
Ernst Tradinik:
Ja, es ist die berühmte Arbeit auf Augenhöhe schon manchmal eine Herausforderung. Ich habe den Eindruck, dass das oft gar nicht unbedingt immer so gewährleistet ist, wie es die jeweiligen Personen vielleicht von sich behaupten würden. Aber das sind eher so Erfahrungen aus dem Betreuungsbereich. Was kann man beachten? Ich glaube, im Grunde, außer dass du vielleicht bei psychischer Erkrankung vorsichtiger agierst und langsamer agierst, du musst schauen, mit welchen Personen hast du zu tun. Das ist es und dann schauen, was kommt.
Christoph Dirnbacher:
Du beschreibst ja in einem Buch, das fand ich echt bemerkenswert, den Franz, der dich dutzende Male pro Tag gefragt hat, wann der Bus kommt, und du dich gefragt hast, wie du sozusagen bei aller Wiederholung ihm wertschätzend begegnen kannst. Deswegen frage ich mich auch in der Medienarbeit oft: Wie kriegt man es hin, dass man am Menschen interessiert bleibt einerseits, ihm auf Augenhöhe begegnet andererseits und trotzdem noch einen gescheiten Bericht, ein gescheites Produkt hingekriegt? Hast du ein Geheimrezept sozusagen?
Ernst Tradinik:
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, dass man sich selber möglichst gut kennt. Genau, und das ist eigentlich eh schon schwierig. Wenn man zum Beispiel ein verkappter RadiomacherIn oder FilmemacherIn ist und solche Projekte begleitet, muss man das wissen. Vielleicht zum Franz zurück: Ich meine, das war eine Situation, wo ich als Betreuer tätig war, und für mich diese Überlegung, wenn mir eine Person 3.500 Mal im Jahr dasselbe fragt und das relativ drängend, du machst kaum die Tür auf und der steht schon vor der Tür und frag dich in einem Tonfall, als wenn es manchmal um Leben und Tod ginge. Für mich war diese Überlegung total wichtig, um zu wissen, warum ich nicht immer gleich freundlich agieren kann. Das hat mich total beruhigt, weil ich mir gedacht habe: Okay, das ist jetzt eine normale Reaktion von mir. Genau, und dann probierst du halt aus. Du probierst aus, wie kann man das anders mit ihm besprechen oder thematisieren, dass er vielleicht dieses Drängen, dass er dem Drängen nicht mehr so nachgeben muss. Irgendetwas beschäftigt ihn da ja zusätzlich, weil die Information, dass der Bus um 7 Uhr 30 kommt jeden Werktag, das hat er ja gewusst.
Christoph Dirnbacher:
Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass du doch im Buch immer wieder Erlebnisse beschreibst, die, kann man sagen, Initialzündungen waren. Eine dieser Initialzündungen war dieser Workshop, den du 2003 gegeben hast. Kannst du uns ein bisschen daran teilhaben lassen, wie diese Erfahrung war und wie sie zustande kam?
Ernst Tradinik:
Ich habe damals gewusst schon, das ist irgendwas ganz Wichtiges. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es jetzt schon richtig fassen kann. Ich habe einen Radioworkshop gemacht, sprich ich habe ein Mischpult mitgehabt, Mikrofon, Kopfhörer, Boxen. Und ich glaube, es waren sechs Personen. Und fünf von den sechs Personen hatten einen aktiven Sprachschatz, also haben gesprochen. und einer nicht. Und dieser eine Herr hat aber genauso bei den Moderationsübungen, ich glaube im Rahmen dessen war das, hineingesprochen ins Mikrofon und wir haben uns diese Moderationsübungen oder Interviewübungen danach angehört und haben drüber gesprochen. Also so wie man es in so Workshops macht. Wie geht es euch dabei, wenn ihr euch selber hört? Wie finden die anderen das? Gibt es Überlegungen dazu, wie man es vielleicht anders machen könnte? Oder wie findet ihr das, dass man mal so Feedback auch bekommt, die eigene Stimme hört und so weiter? Und der eine Herr hat dann das irgendwie übernommen, der nonverbal kommuniziert hat. Und ich war ganz fasziniert von dem, weil er immer wieder seine eigene Stimme angehört hat, mal laut und mal leise. Und mir das total zum Faszinieren begonnen, weil da irgendwas anderes noch drinsteckt. In dieser Arbeit mit Stimme, mit Mikrofon, vielleicht das Kennenlernen von sich selber. Also irgendwas, was man noch in dieser Arbeit anders nutzen kann, neben Radioarbeit, neben Moderation, neben journalistischer Arbeit. Genau. Und das ist ein wichtiger Teil, den man, wenn man darauf achtet, vielleicht nutzen kann. Also dass diese Arbeit am Mikrofon und mit Aufnahmegeräten vielleicht einen anderen Nutzen noch für Personen haben kann, als der Workshop eigentlich ursprünglich gedacht hat.
Christoph Dirnbacher:
Du hast dir drei Länder angeschaut, Österreich, Deutschland und Schweiz. Welches Resümee würdest du ziehen aus der Betrachtung dieser drei Länder? Gibt es Unterschiede, gibt es Gemeinsamkeiten, wie unterschiedliche Staaten an Medienarbeit, an inklusive Medienarbeit herangehen? Weil wenn wir zurückschauen, haben wir ja doch schon, je nachdem, wenn man den Startpunkt berechnet, ab 1975, also 1975 oder doch ein bisschen später, gibt es ja doch schon einige Jahrzehnte zu betrachten.
Ernst Tradinik:
Ich habe mir diese drei Länder auf Wunsch des Verlags angesehen. Andererseits war es beim Unterrichten auch immer so, dass ich mir gedacht habe, das müsste man sich breiter anschauen und das wär so toll, wenn sich aus dem Buch heraus ein weiterer Diskurs ergeben würde und weitere Sendungen, Sendungsteile weiter irgendwie beschrieben werden oder wissenschaftlich erforscht werden. Für mich war es erstaunlich, dass es in Österreich schon eine relativ lange Tradition gibt, nicht zuletzt wegen Freak-Radio zum Beispiel. Mich hat total verblüfft diese frühen Projekte wie Hartheim-TV, sowas fand ich sehr spannend, weil es so vieles von Arbeitsfeldern vereint hat und der Christian Grill sehr ähnlich an diese Arbeit herangegangen ist. Also für jene, die das nicht kennen: Innerhalb einer Institution ein Medienprojekt starten mit Personen, die, wenn man das jetzt so sagen möchte, in einer geschützten Arbeitswerkstätte tätig sind und Fernsehen machen. Und das gab es noch nicht. Sehr schwierige Personen wurden da präsentiert und das hat dann alles so nicht gestimmt, wenn man mit ihnen normal umgegangen ist. Ganz toll fand ich in Deutschland die Projekte der Raul Krauthausen, genau, oder auch „100 percent“. Das sind total tolle Fernsehteile, zum Beispiel dieser eine Teil mit der Amelie Ebner und dem Leonard Grobien, wo es um Dating-Apps geht. Und du siehst zwar Menschen mit Behinderungen, also das ist Fernsehen, man findet es auf Youtube, und die sprechen über Dating-Apps. Also wie kann man jemand anderen treffen. Und sie sprechen darüber, ob sie ihre Behinderung preisgeben, relativ flott oder nicht. Und als Seherin, als Seher vergisst man das eigentlich ziemlich schnell, weil man eigentlich nur zwei jungen, coolen Leuten zusieht, wie sie philosophieren, wie man so eine Dating-App nutzt.
Sandra Knopp:
Die angesprochene deutsche Videoserie mit Amelie Ebner und Leonhard Grobien heißt „100percentme“ und ist auf Youtube zu finden. Eine der ersten österreichischen TV-Produktionen entstand in Oberösterreich im Jahr 1995. Der Titel: „Am Anfang war der Schleifstuhl - eine humorvolle Reise durch vier Zeitepochen.“ 1997 war das Geburtsjahr von Freak-Radio, einer inklusiven Redaktion, deren Sendungen bis heute auf Ö1 Campus ausgestrahlt werden. Daraus entstand in den letzten Jahren auch der Podcast FreakCasters. Ab 1998 gab es in Österreich auch Privatmedien und freie Medien. Erwähnen möchten wir noch einmal Radio Insieme und Hartheim-TV. Zwischen 2002 und 2007 machten bei dem Medienprojekt der Lebenshilfe Oberösterreich Menschen mit Lärmbehinderung oder psychischer Erkrankung Fernsehen. Ernst Tradinik war in den frühen Jahren von Hartheim-TV aktiv beteiligt und hat das Projekt maßgeblich unterstützt. Als Experte für inklusive Medienarbeit brachte er sein Wissen und seine Erfahrungen in die Entwicklung des Projekts ein und trug zur Förderung der Medienkompetenz von Menschen mit Behinderungen bei.
Christoph Dirnbacher:
Was hast du für dich selbst und für deine Arbeit bei den Recherchen zu diesem Buch lernen dürfen? Hast du irgendwas entdeckt, wo du da gedacht hast: Interessant, schon so lange bin ich in diesem Bereich, das wusste ich nicht.
Ernst Tradinik:
Einerseits die Vergleiche eigentlich: Welche Fragen in verschiedenen Ländern, also welche ähnliche Fragen behandelt werden. Wie gleich manches ist, also dieser Artikel über die Gehörlosenpädagogik zum Beispiel. Der Peter Radtke ist uns zum Beispiel wieder untergekommen. Ich kann mich noch dunkel erinnern, ich will meinen, dass ich ihn als Kind gesehen habe im Fernsehen. Und ich kann mich noch erinnern, das kann natürlich an meiner Familie liegen oder meiner Herkunft, wie ungewöhnlich das noch war, dass ein Mensch mit Behinderung als Schauspieler im Fernsehen agiert und wie viel größere Unsicherheit und Angst das noch verbreitet hat damals. Also ich sage es mal so in den Worten, wie es mir jetzt gerade einfällt, das hat mich total erstaunt. Also dieser Peter Radtke zum Beispiel, in welcher frühen Zeit der eigentlich da schon aktiv war und wahrscheinlich mit noch viel größeren gesellschaftlichen Widerständen hat arbeiten müssen.
Sandra Knopp:
Zu Vorreitern in Sachen Barrierefreiheit zählt Tradinik in dem Buch auch Radio FRO in Oberösterreich, das Campus City Radio in Sankt Pölten oder auch den Fernsehsender OKTO mit Sendungen wie Zitronenwasser oder Perspektivenwechsel. Zu den jüngeren Medienprojekten zählt etwa das 2017 gestartete „barrierefrei aufgerollt“ von Bizeps. In der Aufzählung von inklusiven Medienprojekten in Österreich darf auch ein Hinweis auf den inklusiven Spaghetti-Western „5 vor 12“ nicht fehlen. Der Film wurde von Menschen mit und ohne Lernbehinderungen gemeinsam entwickelt und umgesetzt.
Christoph Dirnbacher:
Selber produziert hast du einige eigene Medienprojekte. Ich denke da nur an den Spaghetti-Western oder auch „NA (JA) GENAU“, eine humorvolle Mediensendung. Was war dir bei deinen eigenen Medienprodukten wichtig? Weil du hast wörtlich geschrieben, du willst nicht, dass deine Werke als Brillenträger spezifisch wahrgenommen werden. Das heißt, eine gewisse Breite ist doch wichtig oder geht es da auch um andere Spezifika?
Ernst Tradinik:
Ja, also wenn man Medien produziert, ist natürlich eine Breite wichtig. Wenn das jede Person sehen und hören würde, wäre das natürlich nur recht, weil das ja den Marktwert steigert und weil man dann vielleicht leichter zu anderen Finanzierungen kommt. Bei „Na ja, genau“ ist es so, dass mir mal ein Kollege gesagt hat, die auch eine inklusive Sendung machen, der hat mir gesagt: Ernst, du lässt die Leute ja so reden, wie sie wollen. Und ich hab zunächst überhaupt nicht verstanden, was er meint. Dann war ich mal bei ihm bei ihnen bei einer Sendung eingeladen und dann war mir klar: Die arbeiten einfach, wie man im Fernsehen arbeitet. Du hast wenig Zeit mit einem genauen Skript oder relativ genauem Skript und dann ist klar, wer fragt wann was. Und ich habe mit den Personen bei „NA (JA) GENAU“ so begonnen, dass ich mal geschaut habe, was interessiert die denn, vor allem natürlich was können sie auch, was verstehen sie auch, mit welcher Sprache kann man umgehen und dann möglichst viel Platz gelassen. Marcel Waller war klar, dass der eine rechte Präsenz hat und einen Humor hat. Und je freier man ihn lässt, desto selbstständiger und besser kann er einfach ein Gespräch führen, so wie es für ihn gut passt. Und dann eigentlich für die ganze Sendung. Und bei anderen ist es anders.
Sandra Knopp:
„NA (JA) GENAU“ ist eine inklusive TV-Sendung auf dem Wiener Community-Sender OKTO. Sie wird von jungen Erwachsenen mit Lernbehinderung moderiert und ermöglicht ihnen, ihre medialen Kompetenzen zu erweitern. Für ihre Arbeit wurde „NA (JA) GENAU“ im Juni 2023 mit dem Fernsehpreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Sendereihe ausgezeichnet.
Christoph Dirnbacher:
Du hast vorhin selbst die Finanzierung angesprochen und mir damit quasi die nächste Frage beinahe schon vor die Füße gelegt: Wie finanziert man inklusive Medienarbeit? Muss man das über eine Förderschiene machen? Oder geht das deiner Rechercheerfahrung und persönlicher Erfahrung nach doch in eine Art Kommerzialisierung über Werbung, über Verkauf? Oder gibt's andere Schienen?
Ernst Tradinik:
Ich muss gestehen, mit dem habe ich mich jetzt gar nicht so beschäftigt. Aber ich denke mal, dass die ganze Bandbreite möglich und denkbar ist.
Christoph Dirnbacher:
Und muss ich dafür in den Mainstream oder ist das vielleicht gar nicht das Ziel inklusiver Medienarbeit?
Ernst Tradinik:
Ich glaube, das kommt darauf an, was du willst oder was möglich ist. Warum nicht in den Mainstream? Wenn mir mal jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, du machst eigentlich so etwas wie Unterhaltungsfernsehen, irgendwann hätte ich den ausgelacht, weil ich gesagt hätte, ich mache tolle Dokus ohne Off-Text und das ist dann hochwertig. Aber Unterhaltungs-Sendung kann in dem Sinn ja dann hochwertig sein, wenn Personen kennengelernt werden, die man so noch nicht kennt.
Christoph Dirnbacher:
Inwiefern ist die inklusive Medienarbeit selbst auch eine Spielwiese oder ist es doch ein gewisser Ernst, der da dahintersteckt und dahinterstecken muss?
Ernst Tradinik:
Ich glaube, idealerweise ist es beides. Also gut ist es, wenn man gewisses spielerisches Element, wenn man mit dem herangeht an die Arbeit mit Mikrofon und Radio und Podcast und ähnlichem. Und der Ernst dabei ist natürlich, weil du das so nutzen kannst, dass jemand draufkommt: Oha, ich kann ja selbst irgendwas bewirken, ich kann selbst Interviews machen, ich kann das online stellen oder ich kann es senden lassen beim freien Radio oder ich bewerbe mich beim ORF oder anderen Sendern. Oder man kann das ein bisschen so als Mittel verwenden, ich kann ja jemand interviewen gehen. Das ist ja oft so. Ich kann zu einer berühmten Person gehen unter Anführungszeichen, das kann ich ja selber machen, was ich bisher nicht konnte oder mich nicht getraut habe. Ja, es kann ein beruflicher Wunsch sich daraus entwickeln. Ich kann draufkommen, dass mir die anderen gern zuhören, ich kann draufkommen, dass die anderen das lustig finden, was ich sage, und also in einem guten Sinne humorvoll hören. Also dieser Mix aus Ernsthaftigkeit und Spielwiese finde ich gut.
Sandra Knopp:
Das Buch „Inklusive Medienarbeit“ ist 2024 im Herbert von Halem Verlag erschienen. Das Buch enthält Beiträge von Personen mit Behinderungen, die ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen teilen. Beispielsweise berichtet Cornelia Pfeiffer von der Inklusiven Redaktion der Caritas Oberösterreich über ihre 45-jährige Erfahrung in einer Einrichtung. Außerdem kommt Natascha Toman zu Wort, sie benutzt einen Sprachcomputer. In ihrem Beitrag geht es um unterstützte Kommunikation. Wichtige Inputs holte sich Ernst Tradinik auch vom Publizistik-Professor Fritz Hausjell. Er leitete 2003 den ersten inklusiven Journalismus-Lehrgang.
Christoph Dirnbacher:
Fritz Hausjell war auch einer der Initiatoren vom ersten integrativen Journalismus-Lehrgang, der 2003 abgeschlossen wurde. Und schon damals war die Diskussion: Wie kann man dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung in der Medienbranche leichter Fuß fassen können? Jetzt sind inzwischen mehr als 20 Jahre vergangen und ich stelle dir die Frage wieder: Was braucht es denn, damit Menschen mit Behinderung inklusive Medienarbeit, muss ja nicht unbedingt Journalismus sein, machen können?
Ernst Tradinik:
Die Leute dürfen sich nicht oder müssen sie nicht so fürchten, wenn sich die Leute, also MedienunternehmerInnen, KollegInnen, Gesellschaften nicht so fürchten würden davor, also das ist eine flapsige schnelle herausgeschüttelte These, dann würde es leichter sein. Wenn man sich nicht fürchten würde dafür, dass der oder sie zu wenig kann. Ich war auf der FH zwei Jahre dann zuständig für einen Minibereich, Gender und Diversität für Inklusion, genau. Und das sind eigentlich genau die Themen, die aber sehr schwer besprochen werden, gerade in einer Zeit, wo es ganz viel um politisch korrektes Verhalten geht. Wer traut sich dann auch zu sagen: Nein ich fürchte, der blinde Kollege oder Kollegin kann vielleicht viel weniger, ich bin da vielleicht zuständig, oder bla, bla, bla. Ich glaube, es ist leider immer noch das.
Christoph Dirnbacher:
Das heißt, wenn ich resümiere: Ernst Tradinik empfiehlt, keine Angst vor dem Scheitern, ist es das?
Ernst Tradinik:
Ja, oder sich eigentlich der Angst stellen, dass man sagt: Hey, und offen darüber sprechen. Ich kann es nur so sagen, das politisch Korrekte ein bisschen über Bord werfen. Man muss es ja nicht hinausposaunen, aber in einem geschützten Rahmen darüber reden können, wovor habe ich jetzt eigentlich Angst. Was ist eigentlich wirklich die Sorge? Oder eben umgekehrt. Der Fritz hat gesagt, er empfiehlt immer wieder Medienunternehmen, Menschen mit Behinderungen einzustellen, weil es ja wirtschaftlich Sinn macht. Weil man dann andere zusätzliche Personengruppen vielleicht noch erwischt als LeserInnen oder HörerInnen. Also man kann es auch in diese Richtung anschauen.
Christoph Dirnbacher:
Also beide Seiten sollten keine Angst haben, entnehm ich deinen Worten.
Ernst Tradinik:
Ja. Und man muss sich trauen auch.
Christoph Dirnbacher:
Wohin werden sich Medienschaffende, inklusive Medienschaffende, in Zukunft entwickeln? Ist das eine Frage, mit der du etwas anfangen kannst?
Ernst Tradinik:
Ich hab mit dem Medienzentrum immer wieder zu tun, wenn ich das vielleicht noch kurz erzählen darf. Und die haben mich mal angerufen und gesagt: Hey komm doch mit deinen Leuten vorbei, wir machen auch Jugendradio. Und ich sag im ersten Affekt: Ja klar, mach ich. Und dann habe ich mich eingebremst und gefragt: Warum fragt ihr eigentlich mich? Warum fragt ihr nicht die Leute selber, also kann ich die Nummern geben? Und dann sind wir draufgekommen in dem Gespräch und das war für mich selber erstaunlich, dass sich die Personen selber nicht trauen. Also im Medienzentrum in Wien dürfen alle bis 22 hingehen und sich beraten lassen, man darf sich Videokamera und sowas ausborgen. Man kann Kurse belegen, wie kann ich einen Film gestalten und so weiter. Das dürfen alle, aber die wenigsten, die, wenn man das jetzt so umschreibt, Behinderung haben oder betreut werden, auch die Angehörigen kommen nicht drauf, dass sie ihre Kinder dort einfach hinschicken und sagen, ja geht doch hin. Und die sehen dann schon, wie sie miteinander auskommen. Also die Medienpädagoginnen im Medienzentrum sind total nette, kluge Leute, die es gewohnt sind, andere dabei zu begleiten, wie sie ihre Sendungen umsetzen. Aber es ist noch so neu und so fremd, nach wie vor, dass die Eltern und auch die Betroffenen schwer auf die Idee kommen oder gar nicht auf die Idee kommen, dass ihre Kinder nicht nur in Einrichtungen oder Institutionen gehen können, die nicht ausgewiesen inklusiv sind, aber dabei sind wir ja in einer inklusiven Gesellschaft, sollten wir sein. Das ist wichtig natürlich, aber ich glaube, das habt ihr in euren Sendungen schon x-mal besprochen, von baulichen und gesellschaftlichen Barrieren und digitalen, die längst nicht mehr da sein sollten. Aber ich glaube, es geht wirklich auch um das „Wer traut sich“ und das nutzen, was eh da ist. Und dann haben wir die Leute ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen, damit sie loslegen.
Christoph Dirnbacher:
Man könnte auch das Wasser vorher ein bisschen anwärmen und Unterstützung geben, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ernst Tradinik:
Davon gehe ich dann aus, Christoph. Also bei den MedienpädagogInnen, also das behaupte ich jetzt einfach, weil ich doch einigen kenne mittlerweile, das ist eh kein kaltes Wasser.
Das war FreakCasters für heute. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch und hinterlasst uns eine positive Bewertung und teilt die Episode mit euren Freunden! Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.