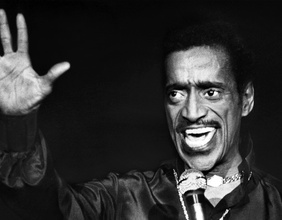PICTUREDESK.COM/ROGER VIOLLET
Radiokolleg
So denkt man anderswo
Österreicherinnen und Österreicher im Ausland.
4. August 2025, 13:19
Zu den Sendungen
Radiokolleg | 11. bis 14. August 2025, 09:05 Uhr
Viel ist die Rede von Menschen aus fremden Ländern, die nach Österreich kommen, um hier ein Leben in Sicherheit mit sozialen und beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten zu finden. Diskutiert wird dabei vor allem die Präsenz von Menschen aus den Konfliktherden der Erde: Sie kommen auf der Flucht vor (Bürger-)Krieg und Gewaltregimen.
Einige von ihnen sind sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft (vor allem für ihre Kinder) nach Österreich kommen. Viele von Letzteren wurden und werden Kleinunternehmer. Ein Indikator dafür ist der Wiener Brunnenmarkt: Waren es in den 1970er und 80er Jahren Türken und Jugoslawen, die Obst, Gemüse, Döner und Kebab verkauft haben, sind es heute Menschen aus Syrien, die dort ihre Waren anpreisen.
Migration als Spiegel der Konflikte
Migrationsbewegungen sind immer auch ein Spiegel der Konflikte, politischen Regime und Krisen der Welt. So wanderten in den 1920er Jahren Tausende Österreicherinnen und Österreicher in die USA aus. Sie waren überwiegend Kleinbauern, die von der Landwirtschaft nicht leben konnten. Viele kamen aus dem Burgenland, das damals eine der ärmsten Regionen Europas war. Danach folgte eine starke Fluchtbewegung aus Österreich - damals die "Ostmark". Juden und Jüdinnen, Kommunist:innen, Sozialist:innen - sie flüchteten vor dem Naziterror in alle Welt. Wenige kamen zurück. Ihre Nachkommen sind längst Staatsangehörige der ehemaligen Gastländer.
Heute leben circa 600.000 Österreicher:innen im Ausland, jedoch unter ganz anderen Vorzeichen. Sie gehen weg, um zu studieren - dank des umfangreichen Erasmus-Programms der EU eine Möglichkeit, von der immer mehr junge Menschen Gebrauch machen. Sie bleiben oder gehen erneut fort, um zu forschen und an Universitäten zu lehren. Sie sind Unternehmer oder wollen berufliche Praxis erwerben und eine Fremdsprache erlernen oder verbessern.

Leopold Federmair
YOSHIKO KIYAMURA
Japan, Argentinien, Italien oder Finnland
Leopold Federmair, seit Jahrzehnten Universitätsprofessor in Japan, berichtet von einer streng hierarchisch aufgebauten Universitätsstruktur und -verwaltung. Wie in (Süd-)Korea ist es in Japan undenkbar, dass ein Student einen Professor kritisiert oder unangekündigt in sein Büro kommt. Für Kreativität oder Spontaneität ist dort kein Platz. Dementsprechend ist die Nobelpreis-Rate, wie Federmair anmerkt, sehr niedrig. Ganz anders in Argentinien oder Italien, wo der Germanist und Schriftsteller Federmair ebenfalls unterrichtet und längere Zeit gelebt hat: Will man gehört werden, muss man laut sein und sich zunächst verbalakustisch durchsetzen. Würde man das in Japan tun, hätte man sich bereits diskreditiert.
Doch auch innerhalb Europas gibt es unterschiedliche Denkschulen, Denkstile und Debattenkulturen. Katharina Tyran, Assistenzprofessorin und Forschende an der Universität von Helsinki, begegnet eine besonders verbindliche, sozial ausgerichtete Lebens- und Diskussionskultur, große Offenheit und Neugier gegenüber dem Fremden - und immer wieder der Blick in den Spiegel der eigenen Gewohnheiten: Warum würden Österreicherinnen und Österreicher eigentlich lieber kurz etwas fragen, anstatt einfach zu fragen?