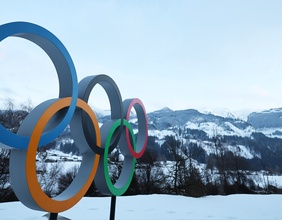Freakcasters | 30. Juli 2025
Jürgen Menze: Gleiche Chancen am Arbeitsplatz
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters - Menschen, Geschichten und Leidenschaften. Es begrüßt euch Udo Seelhofer. Er setzt sich weltweit für Chancengleichheit am Arbeitsplatz ein. Jürgen Menze ist Inklusionsspezialist bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf, kurz ILO, also International Labour Organization. Als Koordinator des Global Business and Disability Network bringt er Unternehmen, Organisationen und Politik zusammen, damit Menschen mit Behinderungen bessere Perspektiven im Berufsleben haben. Ich habe mich mit ihm auf der Zero Conference 2025 in Wien getroffen. Er spricht mit mir über inklusive Arbeitskulturen, internationale Verantwortung und warum Barrierefreiheit weit mehr ist als ein barrierefreier Aufzug.
8. August 2025, 17:42
Udo Seelhofer:
Wie definiert die International Labour Organization berufliche Inklusion und was sind denn die wichtigsten Herausforderungen, damit Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt integriert werden können?
Jürgen Menz:
Ja, wir in der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO, wir definieren Behinderung nicht per se, sondern arbeiten mit der UN-Behindertenrechtskonvention, in der Behinderung als ein Konzept erklärt wird, das sich ständig weiterentwickelt. Aber grundsätzlich bedeutet das, dass Menschen mit Beeinträchtigung, die Barrieren in der Gesellschaft und auch im Arbeitsmarkt erfahren, als behindert gelten sozusagen. Die größten Herausforderungen, die wir sehen, wenn es um die Arbeitsmarktinklusion geht, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir hier über Terminologie sprechen, dass wir Inklusion benutzen und nicht Integration. Weil Integration wäre, jemanden in ein bestehendes System hineinzuzwängen. Und Inklusion bedeutet eben, dass man ein System verändert, damit alle gleichberechtigte Chancen haben. Aber wenn es eben um Arbeitsmarktinklusion geht und auch die Inklusion vor allem in Privatunternehmen, gibt es natürlich eine Reihe von Barrieren. Wir fokussieren uns immer auf die Lösung. Aber wenn wir auf Barrieren gucken, da gibt es natürlich die traditionellen Probleme, wie einfach bauliche Barrierefreiheit, die noch gefördert werden muss, digitale Barrierefreiheit, Prozesse, die anscheinend neutral sind, aber wenn es dann um bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderung geht, sieht man, dass sie eben nicht neutral sind und tatsächlich indirekt diskriminieren. Und all das stammt ja davon, dass wir immer noch in einer, wie man in Englisch nennt, able ist, also in einer behindernden Gesellschaft sozialisiert sind, wir alle, inklusive Menschen mit Behinderung. Und dieses Denken darüber, was bedeutet es, eine Person mit Behinderung zu sein, was bedeutet Behinderung per se, die Interaktion mit Barrieren der Gesellschaft, das ist in unseren Köpfen ja noch drin. Und das ist das Wichtige, dass wir auch gerade im Privatsektor gute Beispiele finden, Unternehmen, die halt gute Arbeit leisten, aber auch vor allem Manager, Leaders, die halt auch offen mit ihrer eigenen Behinderung umgehen, um mal zu sagen, es ist völlig okay, eine Behinderung zu haben, das bedeutet überhaupt nicht, dass ich weniger fähig bin, dass ich diesen Job nicht machen kann. Aber da gibt es halt Riesen-Stigma, Stigmatisierung von Behinderung immer noch in Gesellschaften in der ganzen Welt. Und da müssen wir erstmal dran arbeiten. Nicht erstmal, gleichzeitig, natürlich muss man immer an der Awareness, wie man auf Englisch sagen würde, an der Sensibilisierung arbeiten, gleichzeitig die konkreten Barrieren abbauen, die im System, in Gebäuden und auch in der Kommunikation bestehen.
Udo Seelhofer:
Welche Unterschiede und Herausforderungen gibt es denn bei der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Ländern? Gibt es da bestimmte Länder oder Regionen, die man als vorbildhaft ansehen kann?
Jürgen Menze:
Das ist tatsächlich eine sehr typische Journalistenfrage.
Udo Seelhofer:
Wie oft haben Sie sich schon gehört?
Jürgen Menze:
Ich habe aufgehört zu zählen. Es ist natürlich auch eine berechtigte Frage, aber sehr schwierig zu beantworten. Es gibt kein Land, keine Region, kein Unternehmen, keine öffentliche Institution, die alles richtig macht. Auch nicht die ILO. Da muss man ja auch selbstkritisch sein. Es gibt in Unternehmen, in Ländern, immer bestimmte Bereiche, wo eine Vorreiterrolle gespielt wird. Bei den bestimmten Unternehmen, bei bestimmten Ländern. Aber das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung, Arbeitsmarkt-Inklusion von Menschen mit Behinderung ist natürlich, wenn man ernsthaft damit umgeht, ein sehr komplexes Thema. Nicht komplex im Sinne, dass es so schwierig ist zu bearbeiten, aber wenn man ernsthaft dazu arbeitet, muss man wirklich alle Bereiche eines Unternehmens, alle Bereiche der Gesellschaft wirklich umkrempeln. Und dafür braucht man den politischen Willen. Jetzt nochmal zu der Frage: Sozusagen ein Ranking kann man leider nicht machen oder ich weiß nicht, ob das auch sinnvoll ist. Natürlich kann man immer gucken, was funktioniert gut, welche Länder zum Beispiel haben Public Procurement. Da müsste ich jetzt gerade nochmal gucken, wie man das auf Deutsch nennt. Aber wenn zum Beispiel bei Verträge der öffentlichen Hand mit Privatunternehmen wird das zum Beispiel auch gefördert, dass man da Inklusion mitreinbringt. Das heißt, die bekommen nur einen Auftrag, wenn sie auch Inklusion ernsthaft bearbeiten. Welche Länder machen das gut? Wir als ILO sind nicht für oder gegen eine Quote. Also eine Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderungen. Was wir sagen ist: Wenn es eine Quote gibt, dann muss das richtig eingesetzt werden und nicht als Tickbox-Exercise, das heißt nur auf Papier funktioniert das. Das heißt, lange Rede kurz: Dieses Vergleichen von Ländern ist schwierig, weil da müsste man immer gucken: Über was genau sprechen wir denn? Wie werden zum Beispiel angemessene Vorkehrungen am Arbeitsplatz in einem bestimmten Land geliefert sozusagen? Wie ist es generell mit digitaler Barrierefreiheit? Und da gibt es halt kein Land, das halt alles richtig macht sozusagen.
Udo Seelhofer:
Gibt es denn Länder oder Regionen, die besonders viel Aufholbedarf haben?
Jürgen Menze:
Ja, alle. Teilweise haben wir natürlich hier in Europa, muss man ehrlich sagen, eine gewisse Arroganz und denken, wir haben das schon alles geschafft. Ich habe ja das Privileg, global zu arbeiten mit Unternehmen und nationalen Unternehmensnetzwerken in der ganzen Welt. In Afrika, Asien, Lateinamerika. Und ich bin immer fasziniert, was da auch an innovativen und progressiven Ansätzen verfügbar sind, die man auch in andere Regionen, inklusive Europa, unterbringen kann. Das heißt, da würde ich nicht sagen, dass eine Region besser ist als eine andere. Es kommt, wie gesagt, immer darauf an, wo man sich genau darauf fokussieren will.
Udo Seelhofer:
Wie unterstützt die ILO denn die Entwicklung von nationalen und internationalen Arbeitsmarktstandards, um da eben Inklusion für Menschen mit Behinderung zu fördern?
Jürgen Menze:
Die ILO selbst, ganz kurz zu der Organisation an sich: Uns gibt es seit 1919. Die ILO wurde Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Versailles -Vertrag gegründet. Eine der ältesten, die älteste UN-Organisation. Und die ursprüngliche einzige Aufgabe, sozusagen, war ja eben genau diese Arbeitsstandard zu verabschieden. Im Vergleich zu anderen Organisationen sind wir auch etwas speziell, weil wir eben nicht nur von den Regierungen unserer 187 Mitgliedstaaten regiert werden, sondern eben auch von den repräsentativsten Unternehmerverbänden und Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Und wenn man sich das dann anguckt, dass wir seit über 100 Jahren verschiedene Standards herausgebracht haben als ILO, eben in Verhandlungen mit den Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Regierungen, ist in den letzten Jahren das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung präsenter geworden. Das heißt, manchmal findet man diese Arbeitsstandards, die natürlich immer auf Menschen mit Behinderung angewandt werden sollen. Die werden natürlich nicht exkludiert. Menschen mit Behinderung werden manchmal nicht explizit genannt. Aber alle Arbeitsstandards, es gibt in der ILO verpflichtende, also rechtlich verpflichtende Konventionen und nichtverbindliche Empfehlungen. Empfehlungen und Konventionen werden als Standards bei uns genannt. Aber all diese Standards werden eben auf Menschen mit Behinderung angewandt. Es gibt ja auch aus den 80er-Jahren einen konkreten Standard sozusagen oder eine Konvention zur Inklusion von Menschen mit Behinderung. Das heißt, wir versuchen natürlich immer, das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung explizit in diese Standards reinzubringen. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Aber da geht es natürlich auch um alle Themen, die für die Arbeitswelt relevant sind. Von Arbeitszeit zum Beispiel 2019, die letzte Konvention, die die ILO bislang herausgebracht hat, war zur Beendigung von Gewaltbelästigung oder Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz, wo das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist für Menschen mit Behinderung, die schon am Arbeitsplatz sind.
Udo Seelhofer:
Welche Programme gibt es denn da im Speziellen?
Jürgen Menze:
Wir haben ja gerade über Standards gesprochen. Die Standards oder vor allem die Konventionen werden ja von einzelnen Staaten ratifiziert und die senden uns dann sozusagen ihre Berichte alle paar Jahre, wo man dann natürlich auch gucken kann, was passiert da in den einzelnen Ländern. Zusätzlich haben wir natürlich in der ILO ein kleines, aber effektives Team, das exklusiv sozusagen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen arbeitet. Und da haben wir... Ich zum Beispiel bin der Koordinator des globalen Global Business and Disability Networks, also des globalen Unternehmensnetzwerks zur Inklusion von Menschen mit Behinderung. Das ist ein Netzwerk von... Aktuell hat es über 40 multinationale Konzerne als Mitglieder und auf Länderebene auch 40 nationale Unternehmensnetzwerke zur Inklusion. Da probieren wir halt, den Einfluss von Unternehmen auf globaler, regionaler und nationaler Ebene zu benutzen, um auch Arbeitsmärkte inklusiver zu gestalten. Dadurch vor allem, dass wir halt gute Praktiken, die existieren, replizieren und auch in andere Regionen bringen. Darüber hinaus: Unser Team in der ILO probiert halt dann konkret auch mit den Regierungen vor Ort zu gucken, gibt es da Arbeitsmarktreformen? Gibt es da neue Arbeitsgesetze, wo wir gucken müssen, dass sie halt nicht diskriminierend sind und nicht nur nicht diskriminierend, sondern idealerweise auch fördernd sind für die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Mit Gewerkschaften. Dass wir Gewerkschaften auch benutzen, um halt für die Rechte, Arbeitsrechte von Menschen mit Behinderung einzutreten. Wir probieren vor allem auch in, was man auf Englisch so sagt, emerging trends, emerging topics, also aufkommende Themen, die generell diskutiert werden. Zum Beispiel künstliche Intelligenz, der Übergang zu einer grünen Wirtschaft, Klimawandel, die Care-Economy, also die Pflegeökonomie. All diese Themen sind natürlich auch hochrelevant für die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Da probieren wir auf Policy-Ebene, auf politischer Ebene zu gucken, dass in diesen großen Debatten die Inklusion von Menschen mit Behinderung nicht vergessen wird. Das ist natürlich ein wichtiger Teil von uns, weil wir uns nicht auf so behindertenspezifische Initiativen fokussieren. Was natürlich auch unheimlich wichtig ist. Ich bin ja selber der Koordinator einer behindertenspezifischen Initiative. Effektiver ist es tatsächlich zu gucken, was sind die großen Programme, was sind die großen Initiativen, wo viel Energie, Geld, Unterstützung reinkommt und zu gucken, dass in diesen Debattenprogrammen Menschen mit Behinderung ihren fairen Anteil bekommen.
Udo Seelhofer:
Ist das schwierig?
Jürgen Menze:
Wieder so eine Journalistenfrage! Ja, das kommt wahrscheinlich auf die Personalität an. Was ist schwierig, was nicht. Gestern war ich in einem Event, wo ich nochmal klargemacht habe für mich selbst, und da war das auch öffentlich wiedergegeben, dass in den Zeiten, in denen wir gerade leben, wo es eine große Attacke gibt auf Themen wie Menschenrechte, Nachhaltigkeit, aber eben auch die Rechte von marginalisierten Gruppen wie Menschen mit Behinderung, dass es da umso wichtiger ist, wichtiger als je zuvor, mit Gleichgesinnten sich zusammenzutun, mehr Effizienz und Synergien schafft, um das gleiche zu erreichen. Und ich glaube, das, was wir in unserem globalen Unternehmensnetzwerk machen, versuchen wir natürlich auch über das Netzwerk hinaus zu replizieren, zu kopieren, dass wir immer als Netzwerk auftreten, dass wir immer Alliierte suchen in unserem Kampf für mehr Gleichberechtigung, für mehr Chancengleichheit. Und ich glaube, wenn man die richtigen Partner hat, dann wird die Arbeit sehr viel leichter.
Udo Seelhofer:
Was sind denn die häufigsten Barrieren, auf die Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt stoßen? Und wie kann die ILO dabei helfen, diese zu überwinden?
Jürgen Menze:
Ja, es gibt generelle Barrieren, die sich dann auch im Arbeitsmarkt materialisieren. Ich hatte ja erwähnt, dass vor allem die Auffassung oder die mentale Haltung, die wir alle, fast alle, gegenüber Menschen mit Behinderung haben, natürlich die erste große Barriere ist. Daran müssen wir arbeiten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch tatsächlich ganz konkrete Gesetze in Ländern, wo wir sehen, dass diese Gesetze es schwieriger machen für auch Privatunternehmen, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, weil es eine, sagen wir so, die Intention war gut, die Absicht war gut, Menschen mit Behinderung vielleicht etwas zu schützen. Aber ist dieser Schutz ein etwas paternalistischer Ansatz, so Menschen mit Behinderung sind weniger fähig, was ja nicht wahr ist, und deswegen brauchen sie mehr Unterstützung sozusagen, um halt im Arbeitsmarkt geschützt zu werden. Und diese Gesetze können dann teilweise halt sich negativ auswirken, obwohl sie gut gemeint sind. Und daran müssen wir arbeiten, wir arbeiten weltweit zu gucken, was gibt es da für Gesetzesreformen, wo Gesetze abgeschafft oder revidiert werden müssen, um es einfacher zu machen. Gleichzeitig in meiner Rolle als Koordinator des globalen Unternehmensnetzwerks zur Inklusion arbeiten wir sehr viel mit individuellen Unternehmen zusammen und gucken, wie eine Corporate Culture, wie eine Unternehmenskultur auch geändert werden kann, sodass Menschen mit und ohne Behinderung eine bessere Arbeitserfahrung haben. Weil das ist halt auch ein extrem wichtiger Punkt. Wenn man aus dieser Nischenbetrachtung von Inklusion herauskommt, Inklusion von Menschen mit Behinderung, sehen wir auch: Barrierefreiheit ist ja natürlich nicht nur ein Konzept, das Menschen mit Behinderung ermöglicht teilzuhaben, sondern vielen anderen Gruppen. Zum Beispiel: Als unsere Tochter geboren wurde, bin ich mit dem Kinderwagen durch die Stadt gelaufen und da war ich natürlich auch dankbar für barrierefreie Bürgersteige. Wenn man heutzutage im Bus ist, ein Video guckt und dann gibt es die Untertitel im Video. Das sind alles Beispiele, wo man sagt, das ist vielleicht auch aus einer behindertenspezifischen Perspektive gekommen. Aber letztendlich hilft das anderen Menschen und das ist dann im Arbeitsmarkt genauso.
Udo Seelhofer:
Weil Sie gerade Gesetze erwähnt haben, die Menschen mit Behinderung benachteiligen könnten. Welche politischen Maßnahmen würden Sie sich denn wünschen in diesem Bereich?
Jürgen Menze:
Ja, zum Beispiel ein großes Thema, was wir in manchen Ländern sehen, ist: Wir wissen, es gibt sehr viele Studien dazu, dass in unseren Gesellschaften, in Europa und anderswo, es finanziell eine größere Belastung ist, mit einer Behinderung zu leben, weil die Gesellschaften nicht barrierefrei sind. Das heißt, ich muss als Mensch mit Behinderung höhere Ausgaben tätigen, um Teilhabe möglich zu machen. Und dafür gibt es ja in reicheren Ländern dann teilweise, also auf Englisch sagt man social benefit, eine Sozialleistung für Menschen mit Behinderung, aufgrund der Tatsache, dass halt auch größere finanzielle Kosten gestemmt werden müssen. Was jetzt passiert, was ja richtig ist, was jetzt in einigen Ländern der Fall ist und das ist sehr problematisch, weil dann die Inklusion am Arbeitsmarkt nicht gefördert wird, sondern behindert wird, ist, dass, wenn dann ein Mensch mit Behinderung einen Arbeitsplatz bekommt und in Lohn und Brot ist, dass diese Sozialhilfe sozusagen wegfällt. Und das ist problematisch, weil natürlich die Mehrkosten immer noch bestehen und dann ist es kein Anreiz zu arbeiten, wenn am Ende des Tages nichts übrig bleibt. Das ist halt ein großes Problem, was wir in einigen Ländern sehen und wo wir daran arbeiten müssen, dass wir diese Flexibilität von sozialer Sicherung und Arbeitsmarktinklusion gut in Verbindung bringen. Und das ist ein großes Problem in manchen Ländern.
Udo Seelhofer:
Kommen wir mal kurz zu den Eingliederungsprozessen. Welche Schritte müssen Unternehmen unternehmen, um eine inklusive Rekrutierung und Eingliederung, also Inklusion von Mitarbeitenden mit Behinderung erfolgreich umzusetzen?
Udo Seelhofer:
Ja, zur Einstellung von Menschen mit Behinderung: Der ganze Prozess muss natürlich von A bis Z halt barrierefrei inklusiv gestaltet werden. Wenn in einer Episode sozusagen des Prozesses keine Barrierefreiheit hergestellt wird, dann verliert man potenziellen Kandidaten. Das fängt ja schon damit an, zum Beispiel: Wo macht man das Arbeitsangebot überhaupt verfügbar? Mehr und mehr Unternehmen benutzen natürlich Websites, elektronische Formate. Sind diese Websites zum Beispiel denn barrierefrei? Kann das jemand lesen, der eine Sehbehinderung hat und Software benutzt? Und dann geht es natürlich darum und das ist auch hier ein großes Thema bei der Zero Project Conference hier in Wien: Wie benutzen Unternehmen künstliche Intelligenz, um halt Bewerbungen auszufiltern? Und wenn dann die künstliche Intelligenz, die sehr problematisch ist teilweise, irgendwas aufschnappt, was mit Behinderung zu tun hat, dann wird der Kandidat eliminiert vom Prozess. Wenn man es dann geschafft hat, sozusagen erstmal diese ersten Hürden zu nehmen, ist ja dann häufig auch ein persönliches Interview, ein Gespräch notwendig. Und da muss man gucken, dass halt die Recruiter, die Personaler sozusagen natürlich auch geschult sind, nicht die Fassung zu verlieren, wenn jemand dann mit einem Rollstuhl in das Interviewzimmer kommt und ganz vergessen, dass diese Person natürlich viele Qualifikationen hat. Das heißt, die Leute, die halt auch die Interviews machen, müssen generell nicht nur, wenn sie wissen, okay, jetzt kommt ein Mensch mit Behinderung zu unserem Interview, sondern generell geschult sein sollten, wie man inklusive Interviews macht. Wir sehen auch Studien: Es ist für alle auch besser, nicht nur, ob man eine Behinderung hat oder nicht, wenn man zum Beispiel vorab die Fragen bekommt. Das hilft sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern. Es kommt natürlich auch auf den Typ, die Art der Behinderung an, dass man vielleicht auch, wenn man auf einen Kandidaten zugeht, schriftlich zum Beispiel: Haben Sie den Bedarf, brauchen Sie angemessene Vorkehrungen? Ist da irgendwas, was wir adaptieren müssen? Und vorab schon sagen: Das können wir an Barrierefreiheit anbieten, ist das genug? Gibt es noch irgendwas, was wir bereitstellen sollten, damit Sie an dem Prozess teilnehmen können? Und wenn man dann eingestellt wird, klarstellen auf beiden Seiten: Was wird von der Person erwartet? Und sind die anderen Mitarbeiter und natürlich auch vor allem die Vorgesetzten, wie weit haben sie Probleme mit Menschen mit Behinderung, wie weit sind sie, keiner wird natürlich sagen, ich hab etwas gegen Menschen mit Behinderung, das wird eigentlich keiner sagen, aber dann sicherzustellen, dass Sie wirklich in der Lage sind, behinderungsspezifische Bedürfnisse nicht nur zu verstehen, sondern zu adressieren und auch manchmal Konversationen zu haben, die sie vielleicht zu Hause oder in anderen Kontexten in der Arbeitswelt noch nicht geführt haben.
Udo Seelhofer:
Da kommt aber auch sehr stark darauf an, dass man für die Interviews, wie Sie das gerade angesprochen haben, auch die Menschen in den Personalabteilungen da entsprechend schult und sensibilisiert.
Jürgen Menze:
Ganz genau, ja. Also es ist wichtig, dass zumindest ein grundlegendes Verständnis von Inklusionsthemen da ist. Es gibt natürlich auch viel Material, gratis, online zu gucken: Was sind so Do's und Don'ts, was soll man machen, was darf man nicht machen? Um halt generell einen inklusiveren Prozess zu haben und da ist natürlich, das ist also so die Frontline sozusagen, dass die Personaler, dass sie da keine diskriminierende, ja, keine diskriminierende Dimension reinbringen, auch zum Beispiel Terminologie. Das heißt, man muss halt gucken: Benutzt man auch eine Sprache, die inklusiv ist? Das heißt, in einem Interview da nicht auch irgendwie ein Wort zu sagen, das die Person, die da interviewt wird, als eine Mikroaggression deutet. Klar, die Schulung ist immer wichtig. Ich arbeite ja in dem Bereich jetzt schon 15 Jahre und mehr und täglich lerne ich noch was dazu. Das heißt, man muss kein Experte sein. Aber so grundlegend und teilweise der gesunde Menschenverstand sollte einen dazu bringen, einfach auch mal zu überlegen und nicht nur zu überlegen, sondern auch mal aktiv auf Menschen mit Behinderung zugehen. Weil generell mit Menschen mit Behinderung oder anderen Gruppen, mit denen man wenig zu tun hat, natürlich die Vorstellungen sehr wahrscheinlich falsch sind, weil man überhaupt keinen echten Kontakt hat. Und das ist wichtig, dass man wirklich mehr Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung immer aktiv zusammenbringt. Es gibt sehr viele Menschen mit Behinderung, deren Behinderung gar nicht offensichtlich ist und die dann teilweise auch natürlich ihre Behinderung nicht preisgeben, weil sie in ihrer Erfahrung negative Erfahrungen gemacht haben.
Udo Seelhofer:
Das bringt mich dann gleich zum nächsten Punkt: Wenn man an Inklusion oder Barrierefreiheit denkt, dann denkt man eben an Menschen im Rollstuhl, an Rampen vielleicht, an das Leitsystem für Menschen mit einer Sehbehinderung. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die psychische Probleme haben oder chronische Erkrankungen, die man nicht sieht. Wie kann man da eben das Bewusstsein für Inklusion schärfen?
Jürgen Menze:
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen, die vielleicht nicht so viel über das Thema Behinderung nachdenken, häufig eben eine blinde Person oder einen Rollstuhlfahrer im Kopf haben sozusagen. Und gestern habe ich noch eine Statistik gelesen, dass 92% der Menschen mit Behinderung keinen Rollstuhl benutzen. Das kommt vielleicht für manche als Überraschung, aber so ist es halt, dass die meisten Behinderungen überhaupt nicht offensichtlich sind, nicht direkt wahrnehmbar sind. Sie haben es ja erwähnt: Psychische Erkrankungen oder auch chronische Erkrankungen, die halt mit bestimmten Bedürfnissen dann einhergehen. Und da ist es ja erstmal zu verstehen, dass Behinderung als Konzept nicht ein monolithischer Block ist, sondern sehr in sich selbst das Thema Behinderung sehr divers ist. Und das ist, wie gesagt, dann ist es wichtig, dass man dieses Bewusstsein schärft, dass es eben nicht immer ein Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin ist, eine blinde Person, wie halt die beiden Gruppen sozusagen visuell offensichtlicher sind. Eine taube Person kann man nicht visuell erkennen sozusagen. Und dieses Bewusstsein schärfen ist wichtig, nicht unbedingt immer ganz offensichtlich, dass dieses Bedürfnis besteht. Aber das Bewusstsein zu haben, okay, es gibt sehr viele diverse Gruppen innerhalb der Gruppe von Menschen mit Behinderung. Und da ist es, glaube ich, dann wichtig, dann auch an die Selbstvertretungsgruppen sozusagen, Organisation dieser Menschen mit einer bestimmten Behinderung heranzutreten, um mehr darüber zu erfahren, was das genau bedeutet, was das zum Beispiel auch am Arbeitsplatz bedeuten kann.
Udo Seelhofer:
Welche Benefits haben denn die Unternehmen selbst davon, also von der Inklusion?
Jürgen Menze:
Wie Sie die Frage stellen, hört sich fast so an, als wäre das nur ein Vorteil für Menschen mit Behinderung, wenn sie in Arbeit sind. Nein, also für uns ist ganz klar und wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja über 40 multinationale Konzerne auf globaler Ebene mit uns dabei. Auf Länderebene haben wir über 40 nationale Netzwerke, wo wir auch kleine Unternehmen, man darf jetzt nicht denken, nee, das machen ja nur die großen, weil sie es leisten können. So ist es nicht. Wir haben Netzwerke auf Länderebene, in denen es nur kleine und mittlere Unternehmen gibt. Und diese Unternehmen haben verstanden, dass Menschen mit Behinderung erstmal Menschen sind und gleiche Chancen haben sollen. So. Da ist es schon mal gut, wenn man ein menschenwürdiges Unternehmen ist und Menschen ernst nimmt und fair behandelt. Das ist eine Sache. Gleichzeitig sprechen wir in unserem Kontext immer von einem Kampf um Talente. Kein nachhaltiges Unternehmen kann es sich leisten, talentierte Menschen zu vernachlässigen. Ich sage jetzt nicht, dass Menschen mit Behinderung per se talentierter sind. Das sage ich nicht. Manche sind genauso effektiv, mehr effektiv, weniger effektiv. Das ist ja das Gleiche. Aber man kann nicht aufgrund einer Behinderung sagen, dass man nicht Teil unseres Talent-Pools ist. Das verstehen unsere Unternehmen. Man muss so weit fischen wie möglich, um die besten Leute auf die angemessene Position zu bekommen. Häufig gibt es die Attacke auf Diversity, Equity und Inclusion. Vielleicht muss man eine andere Sprache benutzen. Aber letztendlich geht es darum, ein Unternehmen zu schaffen, das besser funktioniert für alle. Das habe ich vorhin versucht zu erklären. Wenn ein Unternehmen es schafft, effektiv Menschen mit Behinderung zu inkludieren, dann ist das Unternehmen besser für alle Mitarbeiter. Ich identifiziere mich nicht als Mensch mit Behinderung. Aber ich möchte lieber in einem Unternehmen arbeiten, wo Menschen ernst genommen werden, eine faire Chance bekommen. Das hilft auch dem Unternehmen, besser zu sein und einen diverseren Pool von Ideen, Talent und Hintergründen für ihr spezifisches Business Model zu nutzen.
Udo Seelhofer:
Wie könnte innerhalb eines Unternehmens die Weiterbildung von Menschen mit Behinderung inklusiv gestaltet werden?
Jürgen Menz:
Das ist wirklich eine wichtige Frage. Weil wir sehen häufig noch, dass auch gut meinende Unternehmen das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung auf ihre Agenda setzen, aber diese Menschen mit Behinderung teilweise auf der niedrigsten Ebene der Unternehmenshierarchie stecken bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass wir gucken, wenn Menschen mit Behinderung, die als Menschen mit Behinderung bekannt sind, weil es gibt viele Manager mit Behinderung, die aber nicht offensichtlich sind. Gestern war ich in einem Event, wo auch gesagt wurde: Ich habe meinen Chef gefragt, ob er nicht auch irgendwie zu dem Thema Behinderung sprechen will, weil ich weiß, er hat das und das. Und der Chef sagt Nein, weil das Stigma so groß ist. Das heißt, es gibt natürlich auch Führungskräfte, die Behinderungen haben, aber eben aus Angst, als weniger fähig betrachtet zu werden, diese Behinderung gar nicht preisgeben. So weit sind wir noch nicht. Wir arbeiten dran. Es gibt einzelne Führungskräfte, die zum Glück dann sagen: Nein, hier, ich leite ein Unternehmen oder ich bin ein Topmanager, ich habe eine Behinderung. Das hat gar nichts mit meiner Fähigkeit am Arbeitsplatz zu tun. Aber nochmal zu dem Thema Neueinstellungen: Und da zum einen kann man natürlich gucken, dass man die Systeme generell besser gestaltet, dass generell mehr Menschen Aufstiegsmöglichkeiten haben in einem Unternehmen. Was an sich ja schon schwierig sein kann, weil es kommt auf das Unternehmen an, wie viele Karrieremöglichkeiten wirklich bestehen. Dann gibt es halt eben diese, wie man auf Englisch sagt, Affirmative Action, wo man ganz konkret Programme aufsetzt und sagt: So, wir verstehen die systematische Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in Gesellschaften und um diesen Nachteil auszugleichen, geben wir Menschen mit Behinderung einen extra Push sozusagen. Und dann gibt es halt so Mentoring Programs zum Beispiel, wo man halt, weil man eine Behinderung hat, auch näher an Führungskräften dran ist, um halt so ein paar Skills mitzunehmen, um halt auch bessere Chancen beim Aufstieg im Unternehmen zu haben.
Udo Seelhofer:
Eine Frage habe ich noch: Welche Forderungen hätten Sie denn an Politik und Gesellschaft, was sich so in den nächsten 5 bis 10 Jahren dringend verbessern muss?
Jürgen Menze:
Ich hab's eben erwähnt, wir sind gerade in einer Phase, in einem Jahr und vielleicht in einem Jahrzehnt, wo das Thema Menschenrechte, Inklusion, Nachhaltigkeit unter Angriff gekommen ist. Wir dürfen nicht verlieren, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben. Wir müssen mehr zusammenkommen und ganz überzeugt, erst mal überzeugt sein, aber dann überzeugt zu diesen Themen weiterarbeiten und nicht aufgeben und noch mehr zusammenarbeiten. Die Politik muss natürlich gucken: Reden wir überhaupt mit den Repräsentanten von Menschen mit Behinderung? Nicht und nicht nur reden. Nehmen wir deren Meinung wirklich ernst? Menschen mit Behinderung sind ja die Experten, die Expertinnen, wenn es um die Inklusion von Menschen mit Behinderung geht. Das wäre erst mal der erste Ansatz, dass man Menschen mit Behinderung aktiv einbindet und deren Meinung und Empfehlung ernst nimmt. Dann zum Beispiel, wir haben ja darüber gesprochen, welche Gesetze funktionieren vielleicht noch nicht ganz so, wie es sein sollte, aber auch wenn es gute Gesetze gibt, werden die dann wirklich umgesetzt zum Thema Barrierefreiheit. Gestern habe ich lange gewartet auf eine U-Bahn, die tatsächlich barrierefrei ist. Warum? Ich brauche diese Barrierefreiheit nicht, aber ich war mit einer Kollegin da, die einen elektrischen Rollstuhl benutzt. Da war ich tatsächlich negativ überrascht, dass wir da fast 20 Minuten gestanden haben, bis halt fünf U-Bahnen abgefahren sind und man dann rein konnte. Das heißt, gute Gesetze auch wirklich umsetzen und nicht nur auf Papier stehen zu lassen. Das ist ein Appell, den hört man alle Jahre wieder: Wirklich einfach mal zu überlegen, wir sind alles Menschen. Wir wollen alle menschlich behandelt werden und das gilt genauso für Menschen mit Behinderung.
Udo Seelhofer:
Ich denke das war ein gutes Schlusswort. Herr Menze, danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Jürgen Menze:
Ja, vielen Dank an Sie.
Das war „Freakcasters - Menschen, Geschichten und Leidenschaften“ für heute. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn weiter und schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-App eurer Wahl. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ciao und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.