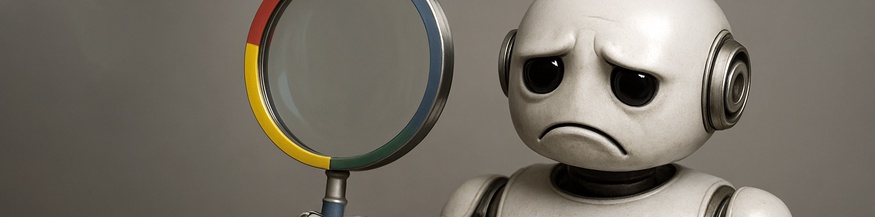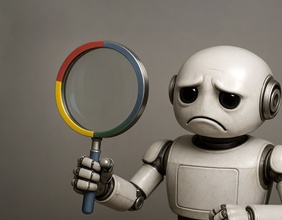PICTUREDESK.COM/BRANDSTAETTER IMAGES/VOTAVA
Radiokolleg | 21 10 2024 - 24 10 2024
Hallo Welt, hier Radio Österreich International!
Das Radioprogramm repräsentiert Österreich in aller Welt. Mit dieser Prämisse nimmt der Kurzwellendienst des Österreichischen Rundfunks Mitte der 1950er-Jahre den Dienst auf. Die Beiträge des heute als Radio Österreich International bekannten Senders richten sich an Auslandsösterreicher und Urlaubende ebenso wie an ein an Österreich interessiertes Publikum.
22. September 2025, 11:27
Ein globales Sprachrohr
Am 1. Jänner 1955 wird der erste speziell für die Kurzwelle produzierte Beitrag mit dem Titel "Eine Woche in Österreich" ausgestrahlt. Kurze Zeit später, am 15. Februar, wird der Programmbetrieb mit dem Forellenquintett von Franz Schubert offiziell eröffnet - die Signation von "Österreich auf Kurzwelle". Ins Leben gerufen und finanziert wird der Sender im Auftrag der österreichischen Bundesregierung. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und in den geopolitischen Spannungen des Kalten Krieges entwickelt sich das Radio zu einem wichtigen Medium der internationalen Diplomatie und des kulturellen Austauschs.
Ermöglicht wird dieser weltweite Empfang durch die Kurzwelle. Dabei handelt es sich um ein Spektrum an elektromagnetischen Wellen, die von der Ionosphäre der Erde reflektiert werden. Das ermöglicht es den Funkwellen, große Distanzen zu überwinden. Amateurfunkern gelingt es, mit ersten Kontinent-übergreifenden Verbindungen das Potenzial dieser Frequenzbereiche aufzuzeigen. Diese von den Rundfunkstationen aufgegriffene Übertragungsmethode hebt das Radio aus dem geografisch begrenzten Empfangsraum auf die Bühne der Welt.
Ende der 1920er-Jahre beginnt die Österreichische Radio-Verkehrs-AG (RAVAG) mit Kurzwellen-Experimenten: Eine Konzertübertragung aus Java wird ebenso ausgestrahlt wie die Eröffnung von Radio Vatikan. Es ist die erste dokumentierte Sendung am 12. Februar 1931, die über Kurzwellen-Relais übertragen wird. Trotz dieser erfolgreichen Versuche wird zunächst nur ein transportabler Kurzwellen-Sender als "wanderndes Mikrofon" für Außenübertragungen verwendet. Die drei Jahre später beginnende, tägliche internationale Programmausstrahlung währt nur kurz und findet durch den Anschluss 1938 und die Zäsur des Reichsfunks ein jähes Ende.
Auf den Wellen zwischen Fakten und Propaganda
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg werden unterschiedliche Sendeanlagen als Provisorien für den Kurzwellen-Radiobetrieb verwendet. Erst in den 1960er-Jahren beginnt der Bau eines eigenen Sendezentrums im rund 25 km von Wien entfernten Ort Moosbrunn in Niederösterreich. Zunächst wird der Sendebetrieb aus einer Baracke mit fünf vom Bisamberg nach Moosbrunn transferierten, ausgedienten U-Boot-Sendern fortgeführt. Zehn Jahre später wird der Kurzwellendienst des Österreichischen Rundfunks über das fertiggestellte Sendezentrum Moosbrunn ausgestrahlt: 23 Stunden am Tag. Sendungen in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch stehen auf dem Programm. Ab dem Jahr 1977 ergänzen Nachrichten in Esperanto den Programm-Mix. Doch trotz Leistungsstarker Antennen und modernster Technik verschlechtert sich die Empfangsqualität. Grund dafür ist die drastische Zunahme an ausländischen Sendern, denn während des Kalten Krieges beginnt ein Boom der Kurzwelle. Sie spielt eine zentrale Rolle im Bereich der politischen Propaganda und der Informationsverbreitung. Staaten auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nutzen für diese Zwecke Kurzwellensender. Radiostationen wie Voice of America oder Radio Free Europe sind oft die einzige Quelle für unabhängige Nachrichten in Ländern mit starker Medienkontrolle und Zensur. Auch Radio Österreich International avanciert zu einer wichtigen Stimme in der internationalen Rundfunklandschaft. Noch während des Jugoslawienkriegs wird Radio Österreich International zusammen mit dem Mittelwellensender Radio 1476 zu einer Plattform der Kampagne "Nachbar in Not". Darüber hinaus werden auch spezielle Programme für die UN-Blauhelme auf den Golanhöhen gestaltet.
Die globale Radiofamilie
Seit den Anfängen des Kurzwellendienstes im Jahr 1955 hat der Sender das Ziel, Österreichs Kultur, Politik und Wirtschaft im Ausland zu repräsentieren. Zu den prominentesten Sendungen zählt das "Österreich-Journal", das mehrmals täglich mit aktuellen Nachrichten aus dem In- und Ausland informiert. Mit dem "Bundesländermagazin" oder "Report from Austria" werden vertiefende Einblicke in regional-österreichische Geschehnisse geboten und die 1997 eingeführte Sendung "Intermedia" richtet sich mit Themen der Medien- und Rundfunklandschaft an die technikaffine Hörerschaft. Im Programm finden sich Ende der 1980er-Jahre Beiträge in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Esperanto und Arabisch. Gestaltet werden die Sendungen in den Fremdsprachenredaktionen von Radio Österreich International. Neben diesen Informationssendungen sind es auch Serviceleistungen wie der Reisenotruf oder täglich aktuelle Seewetter-Werte, mit denen sich das Kurzwellenprogramm bei den im Urlaub befindlichen Österreichern und Österreicherinnen großer Beliebtheit erfreut.
Für den Empfang reicht ein kleines Transistorradio. Anders als bei regionalen Radiostationen beschränkt sich die Interaktion mit dem Publikum nicht auf Zuschriften über Briefe, Postkarten und E-Mails oder gelegentliche Anrufe. Eigene Hörerpost-Sendungen beantworten Fragen und Anliegen der Hörerschaft. Die Zusendung von Empfangsberichten verleiht dem internationalen Radioempfang eine besondere Note. Diese enthalten neben detaillierten Rückmeldungen zu den Inhalten auch Informationen über die Empfangszeit, die Frequenz und die Signalqualität. Als offizielle Bestätigung wird dem Hörer oder der Hörerin eine sogenannte QSL-Karte ausgestellt. Die speziell gestalteten Postkarten werden zu beliebten Sammlerstücken bei Funkamateuren und dem Kurzwellenpublikum. Diese Interaktion und die Freude des internationalen Radioempfangs erschaffen eine sehr enge, über Jahrzehnte und Generationen hinweg andauernde Verbindung zwischen Kurzwellensendern wie Radio Österreich International und dem Publikum.
Ausgesendet, doch nicht verstummt
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der zunehmenden Verbreitung neuer Technologien verändert sich die Rolle der Kurzwelle. Internet, Satellitenradio und DAB (Digital Audio Broadcasting) werden zu einer ernst zu nehmenden Konkurrenz. Das veränderte Radioverhalten durch Streaming- und On demand-Angebote lässt das Interesse an den Kurzwellenprogrammen zunehmend schwinden.
Die zunehmende Digitalisierung führt dazu, dass Rundfunkanstalten notwendige Investitionen in Kurzwelleninfrastrukturen reduzieren oder gänzlich einstellen. Auch Radio Österreich International ist von diesen Entwicklungen betroffen. Politische und finanzielle Entscheidungen führen ab Ende der 1990er-Jahre zum schrittweisen Abbau des Programms. Mit dem am 1. August 2001 in Kraft tretenden ORF-Gesetz beendet die österreichische Bundesregierung die Finanzierung. Nach rund 48 Jahren wird der Betrieb von Radio Österreich International als eigenständiger Sender des ORF Ende Juni 2003 unter Protesten eingestellt. Mit 1. Juli erklingen ausgewählte Sendungen des Klassik- und Kultursenders Ö1 über die Kurzwelle. Diese aus dem nationalen Radioprogramm übernommenen Ausstrahlungen treten mit der Kennung Österreich 1 International die stark reduzierte Nachfolge des Auslandsdienstes an. In infrastrukturarmen Regionen werden die Kurzwellenprogramme hingegen ausgebaut, insbesondere in Afrika, Asien und Teilen des Nahen Ostens. Diese Regionen haben nur geringen Zugang zu digitalen Technologien. Die Kurzwelle bleibt hier eine verlässliche Informationsquelle und spielt auch in Krisengebieten, in denen der Empfang von Internet- und Mobilfunk gefährdet ist, weiterhin eine wichtige Rolle. So hat der Österreichische Rundfunk anlässlich des Krieges in der Ukraine die Sendezeit auf Kurzwelle ausgedehnt, wie eine Pressemeldung von 1. März 2022 informiert. Neben den Ö1 Morgenjournalen werden auch das Mittags- und Abendjournal wieder über das Kurzwellen-Sendezentrum Moosbrunn europaweit übertragen.