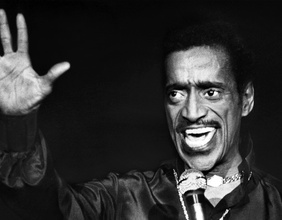Dimensionen - die Welt der Wissenschaft
1. Akustischer Neurostimulator gegen Tinnitus
2. Qualitätskontrolle landwirtschaftlicher Produkte
3. Flugzeug im Keller - Forschung für den Ernstfall
4. Internationales Jahr der Chemie 2011. Das molekulare Küchenlabor - mit Thomas Vilgis
8. Juli 2011, 19:05
Redaktion und Moderation: Franz Tomandl
Ungefähr jeder zehnte Bürger ist dauerhaft von Tinnitus betroffen und nimmt Ohr-Geräusche wahr, die auf keine äußere Schallquelle zurückzuführen sind. Bisherige Therapien zielen im Wesentlichen darauf ab, dass Patienten mit dem " Klingeln der Ohren" leben lernen. Der Physiker und Mediziner Peter Tass vom Forschungszentrum Jülich hat jetzt mit der "akustischen Neurostimulation" die erste Behandlungsmethode entwickelt, die an den Ursachen für Tinnitus ansetzt. Bei krankhaften Ohrgeräuschen feuern alle Nervenzellen in der Hörrinde gleichzeitig ihre Signale ab, anstatt gezielt nacheinander. Die akustische Neurostimulation stellt wieder ein " gesundes Chaos" im Gehirn her. Das geschieht durch ein individuell exakt berechnetes akustisches Programm. Bei einem Internationalen Kongress in Salzburg über "Die Neurobiologie der Psychotherapie" hat Peter Tass die Methode vorgestellt. Autorin: Maria Mayer.
Vergangene Woche hat an der Universität für Bodenkultur die sogenannte CIOSTA-Konferenz stattgefunden. Thema der Veranstaltung waren effiziente und sichere Produktionsprozesse in einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft. Vorgestellt wurde dabei auch ein System, durch das die Qualität und die Herkunft landwirtschaftlicher Produkte kontrolliert werden. Etiketten auf den Produkten senden dabei elektromagnetische Wellen aus. Diese werden von Empfängern im gesamten Verlauf einer Produktionskette registriert. Dadurch soll die Herkunft der Produkte schneller, kostengünstiger und genauer erfasst werden als mit herkömmlichen Methoden. Diese Technik wird unter anderem bei Tieren und tierischen Produkten, Käse und Topfpflanzen eingesetzt, ließe sich aber für alle landwirtschaftlichen Produkte verwenden. Mit Cristina Tortia, Universität Turin. Autor: Mark Hammer.
Eigentlich gehört ein Flugzeug nicht in den Keller. Am Lehrstuhl für Flugsystemdynamik der TU München steht jedoch eines. Ingenieure haben einen Flugsimulator aufgebaut, der Kleinflugzeuge simulieren kann. Damit wollen die Wissenschaftler vor allem Systeme entwickeln, die das Fliegen in dieser Klasse sicherer machen. Denn im Gegensatz zu den großen Passagiermaschinen, in denen das Reisen viel sicherer ist als im Auto oder Zug, gibt es bei den Kleinflugzeugen viele Abstürze jedes Jahr. Der Grund sind häufig Piloten, die noch nicht genug Erfahrung haben und in schwierigen Situationen überfordert sind. Mit Florian Holzapfel, Institut für Flugsystemdynamik, TU München; Falko Schuck, Institut für Flugsystemdynamik, TU München. Autor: Stefan Geier.
Internationales Jahr der Chemie 2011
Das molekulare Küchenlabor - mit Thomas Vilgis aufgezeichnet von Armin Stadler.
Folge 2. Lachstatar: Wenn Proteine denaturieren oder Garen mit Säure
Wenn Biomoleküle ihre Struktur verändern, nennt das der Wissenschaftler "Denaturierung". Dieser Prozess spielt eine herausragende Rolle beim Kochen, weil dabei fast immer Proteine von Nahrungsmitteln verändert werden. Das einfachste Beispiel hierfür ist ein Frühstücksei: durch Hitzeeinfluss - einen physikalischen Prozess - wird das Eiklar fest und weiß; ähnliches lässt sich aber auch durch einen chemischen Prozess erreichen, indem beispielsweise Zitronensaft über das Eiklar geträufelt wird. Nach diesem Prinzip bereitet man auch Lachstatar zu. In seinem zweiten Gericht beschreibt der Physiker und Hobbykoch Thomas Vilgis von der Universität Mainz, wie Fisch bereits durch die Beigabe von Säure zu garen beginnt.
Thomas Vilgis: Molekularküche. Das Kochbuch. - Verlag Tre Torri