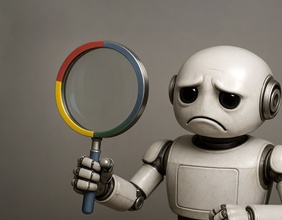PICTUREDESK.COM/AP/ANDREW KASUKU
Punkt eins
Internationale Entwicklungsfinanzierung nach USAID
Lebensgefahr im Globalen Süden: Wie sollen Hilfsprogramme künftig bezahlt werden? Gäste: Dr. Lukas Schlögl, Senior Researcher, Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE); Karin Kuranda, Fachreferentin für Entwicklungspolitik, AG Globale Verantwortung. Moderation: Xaver Forthuber. Anrufe 0800 22 69 79 | punkteins(at)orf.at
8. Juli 2025, 13:00
Als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte US-Präsident Donald Trump zu Jahresbeginn die Mittel von USAID, der Behörde für internationale Entwicklung, drastisch zusammengestrichen. Die Vorgeschichte der United States Agency for International Development geht bis auf den Marshallplan zurück. Lukas Schlögl, auf Entwicklungspolitik und -finanzierung spezialisierter Sozialwissenschafter von der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE), sprach daher schon im Februar von einer "Zäsur", mit der die USA sich von der Nachkriegsweltordnung verabschiedeten. USAID war einer der größten Geldgeber in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit; allein seit 2001 haben die US-Finanzhilfen rund 91 Millionen Menschen im Globalen Süden das Leben gerettet, so eine aktuelle Studie. Bis 2030 könnten nun mehr als 14 Millionen Menschen aufgrund der Kürzungen der US-Hilfen sterben, darunter mehr als 4,5 Millionen Kinder, schätzen die Forscher:innen.
Am vergangenen Dienstag verkündete Trump dann die vollständige Auflösung von USAID - just, als im spanischen Sevilla eine UNO-Konferenz mit dem Ziel tagte, die internationale Entwicklungsfinanzierung zu "retten". Der Finanzbedarf ärmerer Entwicklungsländer vor allem aus dem "Globalen Süden" ist eher sogar im Steigen begriffen - wegen des Klimawandels und der geopolitischen Lage. Neben den USA haben indessen auch andere Länder wie Österreich ihre Mittel gekürzt.
Als der UN-Gipfel am Donnerstag zu Ende ging, fielen die Bilanzen ernüchternd aus. Gastgeber Spanien sprach zwar stolz von einem multilateralen Bekenntnis zur "gemeinsamen Verantwortung" - ob das reicht, um die drastischen Sparmaßnahmen bei internationalen Hilfen auszugleichen, ist allerdings fraglich. "es braucht keinen hohlen Multilateralismus, sondern ein Finanzsystem, an dem alle Staaten gleichberechtigt teilhaben können und das den Interessen aller Menschen dient", sagte Marina Neuwirth vom Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit, Mitglied der österreichischen Delegation in Sevilla. "Und das ist leider nicht gelungen."
Die Länder des Globalen Südens sehen ihre Forderungen nicht erfüllt - etwa ein verbindliches Instrument zur Lösung von Schuldenkrisen, die den finanziellen Spielraum vieler Länder empfindlich hemmen. Karin Kuranda vom NGO-Dachverband AG Globale Verantwortung kritisiert darüber hinaus die mangelnde Einbindung der Zivilgesellschaft auf der Ebene der Vereinten Nationen.
Was wäre eine faire internationale Zusammenarbeit, wie wirkt sie konkret und wie kann sie in Zukunft auf stabile Beine gestellt werden? Worin besteht unsere globale Verantwortung, und wer ist bereit, sie wahrzunehmen? Lukas Schlögl und Karin Kuranda sind zu Gast bei Xaver Forthuber. Reden Sie mit: Rufen Sie in der Sendung an unter 0800 22 69 79 oder schreiben Sie ein E-Mail an punkteins(at)orf.at.
Sendereihe
Playlist
Untertitel: Jackson/Richie/Jones
Bearbeiter/Bearbeiterin: Arr. Guillermo Fernandez
Titel: We Are The World
Ausführende: Guillermo Fernandez
Länge: 04:36 min
Label: Krik Music
Untertitel: Jackson/Richie/Jones
Bearbeiter/Bearbeiterin: Arr. Francesco Parrino
Titel: We Are The World (Piano Arrangement)
Ausführende: Francesco Parrino
Länge: 04:08 min
Label: Manus
Komponist/Komponistin: Antonio Lauro/1917 - 1986
Album: ANTONIO LAURO: VENEZOLANISCHE WALZER FÜR GITARRE
* Danza negra - 2.Satz (00:03:22)
Titel: Suite venezolana (Venezolanische Suite) für Gitarre
Solist/Solistin: Adam Holzman /Gitarre
Länge: 03:26 min
Label: Naxos 8554348