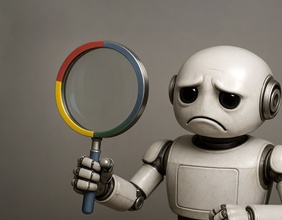PICTUREDESK.COM/SZ-PHOTO/LORENZ MEHRLICH
Punkt eins
Selbstbestimmt mit Hürden
Perspektiven, Chancen und Grenzen von Persönlicher Assistenz in Österreich.
Gäste: Michaela Mallinger, Sensibilisierungstrainerin, WAG Assistenzgenossenschaft & Katharina Müllebner, Peer-Beraterin bei BIZEPS Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Moderation: Marina Wetzlmaier. Anrufe 0800 22 69 79 | punkteins(at)orf.at
26. August 2025, 13:00
Morgens aufstehen und abends schlafen gehen, wann er möchte. In die Arbeit fahren, einkaufen, ein Konzert besuchen. Ohne Persönliche Assistenz wäre das nicht möglich, sagt ein Nutzer dieses Unterstützungsangebots. Er ist Rollstuhlfahrer und kann seine Hände nicht vollständig einsetzen. Bestimmte Tätigkeiten übernimmt daher sein Persönlicher Assistent: von der Körperpflege, Aufgaben im Haushalt bis zur Begleitung bei Terminen oder auf Ausflügen. "Wir sind die Hände und Füße unserer Auftraggeber", beschreibt der Persönliche Assistent seine Arbeit. Die Auftraggeber:innen leiten an, was zu tun ist. Sie bestimmen ihren Tagesablauf selbst, können ein weitgehend eigenständiges Leben zuhause führen und an der Gesellschaft teilhaben. So der Anspruch von Persönlicher Assistenz, die es für den Arbeitsplatz, die Schule und die Freizeit gibt.
Allerdings hängt es in Österreich vom Wohnort ab, ob und in welchem Ausmaß man diese Unterstützung erhält. Während Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz über den Bund geregelt wird, sind für den Privatbereich die Bundesländer zuständig. Die Folge sind unterschiedliche Rahmenbedingungen: In Wien sind Menschen anspruchsberechtigt, die eine körperliche Behinderung haben und Pflegegeld ab der Stufe 3 beziehen. In Niederösterreich ist Pflegestufe 5 Voraussetzung. Während in Oberösterreich Menschen mit Sinnesbehinderungen Persönliche Assistenz beantragen können, ist das in Wien nicht möglich. Das gilt auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder psychischen Erkrankungen. In Kärnten hingegen haben Personen mit Lernschwierigkeiten zwar Anspruch auf Assistenz, allerdings ist diese generell auf den Zeitraum zwischen 6:00 und 22:00 Uhr beschränkt.
Seit Jahren fordern Interessensvertretungen österreichweit einheitliche Rahmenbedingungen. Das Sozialministerium setzte im Jahr 2023 eine Richtlinie zur Harmonisierung der Persönlichen Assistenz in Kraft. Darin wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. Außerdem war eine bessere arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Absicherung der Assistent:innen vorgesehen, denn viele sind in prekären Arbeitsverhältnissen tätig. Pilotprojekte starteten zunächst in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Kärnten und das Burgenland zogen nach. Für die Umsetzung förderte der Bund bis zu 50 Prozent der Kosten. Von einem "Meilenstein in der österreichischen Behindertenpolitik" sprachen Organisationen wie der Österreichische Behindertenrat. Für andere war es lediglich ein "erster Schritt". Mittlerweile fehlt für die Weiterführung des Pilotprojekts die nachhaltige Finanzierung. Zudem wollen nicht alle Bundesländer mitmachen.
Welche Perspektiven hat die Persönliche Assistenz in Österreich, ein Konzept, das von Menschen mit Behinderungen entwickelt wurde und aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung kommt? Kann das Angebot den Bedarf decken? Betroffene berichten von zu wenig verfügbaren Assistent:innen, langen Wartezeiten und zu geringen Stundenkontingenten. Welche Folgen hat das? Wie organisiert man generell den Alltag mit Persönlicher Assistenz?
Darüber spricht Marina Wetzlmaier mit Michaela Mallinger von der WAG Assistenzgenossenschaft, die Menschen dabei unterstützt, Persönliche Assistenz zu organisieren, und mit Katharina Müllebner von der Beratungsstelle BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben.
Reden Sie mit: Rufen Sie an unter 0800 22 69 79 (kostenfrei innerhalb von Österreich) oder schreiben Sie ein E-Mail an punkteins(at)orf.at
Sendereihe
Playlist
Komponist/Komponistin: Robbie Robertson
Titel: The Unfaithful Servant (davon 11 Sek. unterlegt)
Ausführende: The Band
Länge: 04:15 min
Label: Capitol Records
Komponist/Komponistin: Steven Drozd & Wayne Coyne
Titel: All We Have Is Now (davon 11 Sek. unterlegt)
Ausführende: Vitamin String Quartet
Länge: 03:49 min
Label: Vitamin Records
Komponist/Komponistin: Mick Jagger & Keith Richards
Titel: You Can't Always Get What You Want
Ausführende: The Rolling Stones
Länge: 07:27 min
Label: ABKCO Records