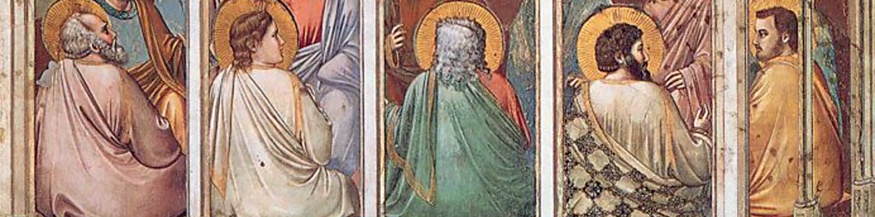Bestbezahlte Schauspielerin in Nazideutschland
Das Leben einer Diva
Mit dem Film "Zu neuen Ufern" gab Zarah Leander 1937 ihr Filmdebüt in Berlin. Bereits Wochen vor dem Filmstart berichteten Zeitungen und Wochenschauen über den neuen Star des deutschen Films. Die Operation Leander war angelaufen.
8. April 2017, 21:58
Leander über den Glauben an ihre künstlerische Berufung
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten waren weder Greta Garbo noch Marlene Diedrich bereit, nach Deutschland zurückzukehren. Ein Ersatz wurde gesucht. Und diesen hatte der Vizechef der Reichsfilmkammer Hans Weidemann 1936 in Wien entdeckt. Dort spielte die 30-jährige Schwedin Zarah Leander am Theater an der Wien in dem Singspiel "Axel an der Himmelstür."
Hans Weidemann bot Zarah Leander noch in Wien einen Exklusivvertrag mit der UFA an - und er akzeptierte ihre Gagenforderungen von 200.000 Reichsmark pro Jahr: die Hälfte auszuzahlen in Schwedischen Kronen. Was Weidemann nicht wusste war, dass Zarah Leander knapp bei Kasse war. Sie wohnte in einer zugigen Veranda in Grinzing und nutzte geschäftliche Meetings, um sich satt zu essen. In den Verhandlungen mit Weidemann pokerte sie hoch - und gewann.
Sara aus Karlstad
Zarah Leanders Weg von ihrem Geburtsort, dem kleinstädtischen Karlstad in Mittelschweden, zur Filmdiva der UFA Studios war keineswegs vorgezeichnet. Sara Stina Hedberg kam 1907 als Drittes von fünf Kindern in einem protestantischen, gut bürgerlichen Haushalt zur Welt. Der Vater, Anders Hedberg, war Kaufmann und Häusermakler.
Im Kreis der großen Brüder hatte Sarah keinen leichten Stand. Denn ihre musikalische Begabung wurde nicht besonders ernst genommen. Und mit ihrem naturroten Haaren und den unzähligen Sommersprossen im Gesicht entsprach sie keineswegs dem Schönheitsideal der Jahrhundertwende. Der Vater aber unterstützte sie dabei, sich vom hässlichen Entlein in eine kleine Prinzessin zu verwandeln.
Kinder, Küche, Provinz
Auch gegen den Willen der Eltern entschloss sich die 19-Jährige die Aufnahmeprüfung an der Königlichen Schauspielschule in Stockholm zu versuchen. Sie trat an - und fiel durch. Nun einmal in Stockholm gelandet, wollte sie nicht mehr zurück in die Provinz und nahm eine Stelle in einem Musikverlag an.
Den Traum von einer künstlerischen Karriere konnte sie vorerst nicht verwirklichen. Sie lernte den Schauspielschüler Nils Leander kennen. Zarah wurde schwanger, heiratete und zog auf den Pfarrhof ihrer Schwiegereltern in Risinge in Östergötland. Noch im selben Jahr wurde die Tochter Boel geboren. Eineinhalb Jahre später der Sohn Nils. Und der Ehemann Nils Leander begab sich mit seinem Tourneetheater auf Reisen - während Zarah zu Hause auf ihn wartete.
Alt statt Sopran: Revuen in Stockholm
Doch Sarah arbeitet an sich. Sie besorgt sich Notenmaterial und lernte Chansons. Als sie erfuhr, dass im benachbarten Norrköping Rolfs Revuetheater gastiere, fuhr sie hin, um vorzusingen - und wurde engagiert. Zarah Leander reüssierte als Revuestar. Und binnen weniger Monate hatte sie ihr ursprüngliches Ziel wieder erreicht: Stockholm. 1930 engagierte sie der Theaterdirektor Karl Gerhard für seine Revue.
1932 ließ sie sich von ihrem Mann Nils scheiden und kam nun allein für den Unterhalt ihrer Kinder auf. Unterstützt von ihrer Mutter, die zur Tochter und den Enkelkindern nach Stockholm zog, bewohnte die Familie eine kleine Wohnung am Stadtrand. Das Geld war knapp, doch Zarah Leander verstand es, sich in den Medien zu inszenieren.
Der Leander verhalfen aber nicht nur der Reiz des Exotischen, ihre dunkle Stimme und die auffallende Erscheinung zum Durchbruch. Sie besaß die Fähigkeit, in jedem Lied eine Figur zu entwerfen und die Gefühle dieser Figur glaubhaft zu interpretieren.
Kultureller Markenartikel Nazideutschlands
Zarah Leanders Aufstieg zur Filmdiva des Nationalsozialistischen Deutschlands schien unaufhaltsam. Ihre dunkle Stimme mit dem rollenden "R" wurde allgegenwärtig. Ob im Wunschkonzert der deutschen Wehrmacht, oder als Gesangseinlage vor den Nachrichten: Die Leander wurde zum kulturellen Markenartikel von Nazideutschland.
Ihre künstlerischen Erfolge wurden im neutralen Schweden durchaus positiv kommentiert. Als 1943 jedoch Bomben auf Berlin fielen und sich das Reichspropagandaministerium weigerte, Zarah Leanders Gage in Schwedenkronen auszuzahlen, verließ sie Berlin und zog auf ihr Gut nach Südschweden.
Fast ein Berufsverbot
Voll Optimismus erwartete sie, ihre Karriere an den Stockholmer Revuetheatern wieder aufnehmen zu können. Umso schockierender war für sie die Reaktion der Schwedischen Öffentlichkeit. Denn die Künstlerkollegen und Journalisten bezeichneten sie als Kollaborateurin des Nationalsozialistischen Regimes. Öffentliche Auftritte wurden ihr verwehrt.
Sechs Jahre lang sollte Zarah Leander nicht mehr öffentlich auftreten. Nach Kriegsende erklärten sie die Alliierten zu persona non grata. Ihre Filme wurden nicht mehr gezeigt. Ihre Lieder nicht reproduziert. Erst mit in den 50er Jahren und mit dem kalten Krieg setzten vor allem die Amerikaner auf eine neue Kulturpolitik: die der Restauration. Und ungeliebte Stars der UFA traten wieder ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Unter ihnen war Zarah Leander.
Sie starb im Alter von 74 Jahren 1981 auf ihrem Landgut in Lönö.
Hör-Tipp
Radiokolleg, Donnerstag, 15. März 2007, 9:45 Uhr
Buch-Tipps
Micaela Jary, "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n", Berlin Aufbau Taschenbuchverlag, ISBN 9783746617510
Jutta Jacobi, "Zarah Leander. Das Leben einer Diva", Hoffmann & Campe, ISBN13: 9783455500103
Mehr dazu in oe1.ORF.at
Links
Wikipedia - Zarah Leander
Zarah Leander - deutschsprachige Fansite