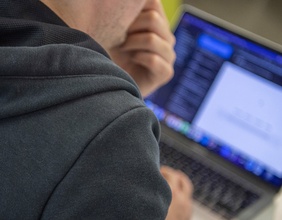Sirene und Doppelmoral
Etgar Keret und sein Israel
Dass er zu schreiben begonnen hat, war nicht geplant. Dass seine Storys veröffentlicht wurden, war Zufall. Dass er mit einem Palästinenser ein Buch schrieb, ergab sich. Und dass eine arabische Übersetzung seiner Storys zustande kam, war Schicksal.
8. April 2017, 21:58
Für Etgar Keret ist Israel absurd. Einerseits so konservativ, dass am Sabbath keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, andrerseits aber so offen, dass beim European Song Contest ein Transvestit für Israel singen darf. Es ist kein Problem, wenn sich ein Altersheim mit inkontinenten Bewohnern "Rabin Hospital" nennt, wenn man aber eine Katze Rabin tauft, gibt es Ärger. Seine Geschichte "Sirene" wurde zwar in den verbindlichen Kanon für die höheren Schulen übernommen, aber viele Lehrer weigern sich, diese im Unterricht durchzunehmen.
Die Geschichte erzählt von einem Buben, der gerade verprügelt wird und nur deshalb seinen Peinigern entkommt, weil er eben nicht, wie es Vorschrift ist, während des Sirenengeheuls am Holocaust-Gedenktag zwei Minuten lang reglos verharrt, sondern davonläuft. Und das, so argumentieren die Gegner der Sirene-Geschichte, ist nicht das Verhalten einer positiven Figur. So könnten die jungen Menschen auf die Idee kommen, die Gedenkminuten, den Holocaust-Gedenktag und in weiterer Folge die Grundlagen der Gesellschaft zu missachten.
Das System der Strafrunde
Die Absurdität im Leben des Etgar Keret scheint System zu haben. Sie beginnt schon mit seinem Namen. Wörtlich übersetzt bedeutet er "städtische Herausforderung" - ein toller Name für Sportschuhe, meint Etgar Keret, aber in der Armee hat man damit ziemlich schlechte Karten. Dass er an seinem ersten Tag als Rekrut bereits Strafrunden mit schwerem Gepäck laufen musste, hatte er aber seinem losen Mundwerk zu verdanken: Er fragte den Ausbildner, weshalb es denn nötig wäre, das Rundenlaufen als Strafe zu tarnen, wenn es doch sowieso zur Ausbildung gehöre und ob nicht ein wenig Ehrlichkeit im Umgang miteinander anzustreben wäre.
Lange vor dem Strafrundenziel beendete er das grausame Spiel, indem er einen Asthmaanfall vortäuschte, was in weiterer Folge zu seiner Versetzung in den Innendienst führte: Er sollte einen Computer beaufsichtigen. Das war so langweilig, dass er sich die Zeit mit dem Erfinden einer Geschichte vertrieb. Doch das machte ihn noch längst nicht zu einem Autor.
Frühgeschichten
Eigentlich wollte er Ingenieur werden, bekam sogar ein Stipendium, hatte aber Probleme mit den in aller Morgenfrühe angesetzten Vorlesungen. "Du musst irgendetwas als Grund nennen", sagte sein Mentor, "das erklärt, weshalb du es nicht schaffst, des Morgens pünktlich zu erscheinen. Sonst verlierst du das Stipendium." Worauf ihm Keret einige seiner Geschichten gab und meinte, dass er manchmal schreibe.
Ein Jahr später traf er zufällig den Menschen, dem sein Mentor die Geschichten gegeben hatte, "und der wollte mehr von dem Zeug", erzählt Keret. "So entstand mein erstes Buch."
Das letzte Frühstück vor der Abreise
Später dann traf er zufällig auf jenen Palästinenser, der seine Geschichten vom Englischen ins Arabische übersetzte. Das war in Norwegen gewesen, während einer Konferenz über die Auswirkungen des 11. September. Er sollte an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, aber das wollten die anwesenden Palästinenser nicht - was Jacques Derrida so in Rage brachte, dass er dieses Verhalten in seiner Schlussrede lautstark und öffentlichkeitswirksam anprangerte und zumindest das erreichte: Keret und die anwesenden Palästinenser nahmen das letzte Frühstück vor der Abreise gemeinsam mit Derrida ein.
Als Keret sein einziges englisches Exemplar von "The Bus Driver Who Wanted to Be God" an Derrida verschenkte, waren die anderen wieder beleidigt. Was Keret, wieder zuhause in Tel Aviv, durch ein Postpäckchen wieder gut machen wollte.
Monatelang keine Reaktion. Schließlich kam ein Brief aus Ramallah: "Ich liebe Ihr Buch, ich habe es übersetzt und ich werde es bei uns veröffentlichen, wenn das für Sie okay ist." Izzat al-Ghazzawi hieß der mutige Übersetzer. Eine Woche, bevor das Buch erschien, starb er an einem Herzinfarkt.
Israelischer Antisemit?
Als Autor hat Etgar Keret in Israel mittlerweile Kultstatus. Die Gefängnisinsassen wollen seine Bücher lesen oder eben keine. In den Buchhandlungen werden seine Bücher am öftesten gestohlen. In der Knesset wurde nach einer Ausstrahlung verfilmter Keret-Sketches im israelischen TV ernsthaft erwogen, ob Keret nicht eigentlich Antisemit sei. Ihm ist das egal. Diese Art von Kategorie interessiert ihn nicht.
Hör-Tipp
Terra incognita, Donnerstag, 15. Februar 2007, 11:40 Uhr
Buch-Tipps
Etgar Keret, "Mond im Sonderangebot", btb, ISBN 3442734991
Etgar Keret, "Pizzeria Kamikaze", Luchterhand, ISBN 3630870686
Etgar Keret, "Der Busfahrer, der Gott sein wollte", Luchterhand, ISBN 3630870899
Rafik Shami (Hg.), "Angst im eigenen Land", Nagel & Kimche, ISBN 3312002818
Links
The Believer - Interview mit Etgar Keret (engl.)
Wikipedia - Etgar Keret