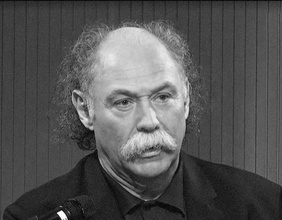"Bewegt, doch nicht zu rasch"
Robert Schumanns letztes Klaviertrio
Nicht nur in Österreich feiert man heuer einen großen Komponisten. Am 23. Juli jährt sich der Todestag von Robert Schumann zum 150. Mal. Im Zentrum steht diesmal sein drittes und letzte Klaviertrio in g-Moll, Opus 110, entstanden im Oktober 1851.
8. April 2017, 21:58
Ein Thema: 4. Symphonie und Klaviertrio Op. 110
Robert Schumanns drittes und letztes Klaviertrio in g-Moll, Opus 110, ist in Düsseldorf, in der ersten Oktoberwoche 1851 entstanden. Es ist dem dänischen Kollegen Niels Gade gewidmet. Gade war Mendelssohns Assistent in Leipzig gewesen und für eine ganz kurze Zeit nach Mendelssohns Tod 1847 dessen Nachfolger als Chefdirigent des Gewandhaus Orchesters.
Als dann aber der Krieg zwischen Preußen und Dänemark ausbrach, musste Gade nach Kopenhagen zurückkehren. Dort blieb er bis zu seinem Tod 1890.
Zeit der Spannung
Ein Schlüsselwort für Schumanns Klaviertrio, das relativ selten auf den Konzertprogrammen aufscheint, ist Unruhe, bewegte Unruhe. "Bewegt, doch nicht zu rasch". Dieser Angabe Folge zu leisten, haben Klavier, Violine und Violoncello im ersten Satz aus Schumanns g-Moll-Klaviertrio, entstanden in seiner letzten Lebensperiode, als Schumann und Clara in Düsseldorf lebten. Es ist eine Zeit der Spannungen und Frustrationen. Die Beziehungen mit dem Städtischen Orchester, dessen Leitung Schumann 1849 übernommen hatte, gestalten sich sehr schwierig.
Clara notiert im Oktober 1851 ins Tagebuch:
Robert arbeitet sehr fleißig an einem Trio für Klavier, Violine und Violoncell, doch lässt er mich durchaus nichts davon hören, als bis er ganz fertig ist- ich weiß nur, dass es aus g-Moll geht.
Aufführung mit Clara
Zwei Wochen später wird das Werk im privaten Rahmen im Hause Schumann aufgeführt, am Klavier natürlich Clara, an der Violine Wilhelm Joseph von Wasielewski, Konzertmeister des Düsseldorfer Orchesters und am Cello der Düsseldorfer Cellist Christian Reimers.
Jetzt, wo sie es kennt, schreibt Clara im Tagebuch:
Es ist originell, durch und durch voller Leidenschaft. Was ist es doch Herrliches um einen so rastlos schaffenden gewaltigen Geist, wie preise ich mich glücklich, dass mir der Himmel Verstand und Herz genug gegeben hat, diesen Geist und dies Gemüt so ganz zu erfassen. Oft befällt mich eine heiße Angst, wenn ich daran denke, welch glückliches Weib ich bin vor Millionen andern, und dann frage ich oft den Himmel, ob es auch nicht zuviel des Glücks ist. Was sind alle Schattenseiten, die das materielle Leben mit sich bringt, gegen die Freuden und die Wonnestunden, die ich durch die Liebe und die Werke meines Robert genieße...
Umstrittene Beurteilung
In Fachkreisen wurde das Werk als Beweisstück für die nachlassende inspiratorische Kraft des Komponisten herangezogen. Das Schumann-Jahr 2006 bringt hoffentlich hinsichtlich des Spätwerks neue Erkenntnisse und Beurteilungen.
Das g-Moll-Trio ist in Düsseldorf entstanden. Die Stadt wird zum Hintergrund für den endgültigen Ausbruch der Krankheit, der geistigen Verwirrung, seines Verfalls: ein äußerst schmerzvoller Lebensabschnitt, Ermunterung, gleichzeitig auch Irritation im Zusammenleben der Eheleute bringt nur die Ankunft des jungen Johannes Brahms.
Themen-Verwandtschaften
Was schreibt Schumann im gleichen Jahr 1851, welche Kompositionen stehen dem g-Moll Trio nahe? Die zwei Sonaten für Violine und Klavier Op. 105 und 102, die Ball-Szenen für Klavier vierhändig, Op. und die drei Fantasiestücke für Klavier Op. 111.
Und das Hauptthema aus Schumanns Sinfonie in d-Moll. Wir können es im Scherzo des g-Moll-Trios wieder erkennen, das laut Clara besonders "durch und durch voller Leidenschaft ist und einen bis in die wildesten Tiefen mit fortreißt."
Mehr dazu in Ö1 Programm
Links
Wikipedia - Robert Schumann
Wikipedia - Clara Schumann
Wikipedia - Niels Wilhelm Gade
Übersicht
- Interpretationen