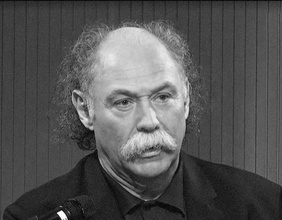Die Kultur des Verlierens - Teil 1
Aufgegeben wird nur ein Brief
Es gibt im Sport Phänomene, die den Eindruck zwangsläufig wiederkehrender Gesetzlichkeiten erwecken, obwohl sie statistisch gesehen seltener sind, als es den Anschein hat. Zu diesen Phänomenen gehört beispielsweise das "Gesetz der Serie".
8. April 2017, 21:58
Eine Mannschaft "hat ihren Lauf" und ist wochenlang nicht zu stoppen; ein Spitzenleichtathlet hat in einem bestimmten Stadion noch nie gewonnen und muss sich, gewissermaßen selbstverständlich, auch diesmal mit dem zweiten Platz begnügen; ein Anderer belegt seit Monaten oder gar Jahren bei jedem größeren Wettkampf den undankbaren vierten Platz.
Solche Serien gibt es. Es kommt immer wieder vor, dass eine Sportart relativ lange Zeit von einer einzigen Athletin, einem einzelnen Athleten oder einer einzelnen Mannschaft eindeutig dominiert wird, und es kommt auch vor, dass ein Athlet jahrelang auf den zweiten Platz abonniert ist, weil ein noch besserer Athlet den ersten blockiert.
Doch in den meisten Sportarten ist der Wechsel von Chancen und Rangplätzen sehr viel häufiger und Unberechenbarkeit das eigentliche Charakteristikum. Dass man nicht sicher sein kann, wie es ausgeht, ist bei fast allen Wettkämpfen ein entscheidendes Attraktionsmoment.
Aber auch die überraschende Wendung wird - in der Sportberichterstattung, in der Perspektive der Zuschauer und manchmal auch im Selbstverständnis der Aktiven - leicht ins Licht der Zwangsläufigkeit gerückt. "Wenn die in der Pause zurückliegen, gewinnen sie jedes Mal", heißt es dann zum Beispiel, auch wenn erst wenige Tage vorher der negative Pausenspielstand in der zweiten Spielhälfte noch verdoppelt wurde.
Dass durch Verluste und Niederlagen Kräfte geweckt werden, welche die Siegeschancen - sei es noch im laufenden Wettkampf oder beim nächsten Mal - erhöhen, gehört zu den Thesen, mit denen Trainer manchmal ihre Schützlinge motivieren, um einen Abwärtstrend zu stoppen. Die Annahme gehört aber auch bei vielen Fans zu den Glaubenssätzen, die sich auch nach mehrfachen Falsifikationen immer wieder erneuern.
Von Spielen, bei denen eine Mannschaft durch Gegentore geweckt wird und dann das Spiel noch "umdreht", geht eine besondere Faszination aus. Im Langzeitgedächtnis der Fußballanhänger haften nicht nur besonders hohe Siege ihrer Mannschaft, sondern gerade auch Spiele, die verloren geglaubt waren, aber - womöglich im letzten Moment - noch eine positive Wendung nahmen.
Die Spielzeit 2000/2001 der deutschen Fußball-Bundesliga bot dafür ein Beispiel, das dramatischer nicht hätte inszeniert werden können. Beim letzten Spiel der Saison kam Schalke 04 erst nach zwei Gegentoren in Schwung, errang noch einen klaren Sieg und schien beim Schlusspfiff Deutscher Meister, weil Bayern München zu diesem Zeitpunkt in Hamburg 1:0 zurück lag. Aber dann stürmte die Bayernmannschaft, angetrieben von ihrem exzentrischen Mannschaftsführer Effenberg und von verzweifelter Hoffnung, glich aus in der 94. Minute und rettete so den Meistertitel.
Das war eine so extreme Zuspitzung, dass selbst nüchterne Trainer und besonnene Journalisten von "Magie" und "Wahnsinn" sprachen. Der Fußballgott, zum ersten Mal inthronisiert nach dem siegreichen deutschen Weltmeisterschaftsfinale von 1954, tauchte wieder in Berichten und Kommentaren auf.
"Gott ist ein Bayer" titelte die Münchner "Abendzeitung" - der Fußballgott wurde so oft beschworen, dass Geistliche schließlich ex cathedra verkündeten, es gebe keinen. Der bayrische Ministerpräsident formulierte deshalb etwas vorsichtiger: "Das Glück hilft nur denen, die alles geben".
Er nahm damit eine Gegenposition ein zu der Volksweisheit, die besagt, dass das Glück ein Rindvieh sei. Fußball ist auch ein Glücksspiel, eine Komposition aus Unberechenbarkeiten. Aber dramatische Zuspitzungen wie in jenem Meisterschaftsfinale wirken nicht zufällig, sondern schicksalhaft.
Es wäre gewiss nicht uninteressant, empirisch-statistisch zu untersuchen, in welchen Fällen Gegentore nützlich sind und in welchen sie schlicht zum Desaster führen. Aber unabhängig von der tatsächlichen Gewichtung repräsentieren die Fälle, in denen Spiele noch "umgedreht" werden (und Vergleichbares gibt es in allen Wettkampfsportarten), den Befund, dass Schwierigkeiten zur Mobilisierung von Kräften führen können.
Das ist kein besonders aufregender Befund, aber doch eine Erkenntnis, die bei der Ausübung von Sport ständig gegenwärtig gehalten werden muss - gerade weil es sich um keine zwingende Gesetzlichkeit handelt: Gegentore führen ja nicht immer zum Aufbäumen, und das Aufbäumen führt nicht immer zum Sieg.
Dieser Text entstammt einer Kooperation mit "Anstoss", der Zeitschrift des Kunst- und Kulturprogramms zur FIFA WM 2006; ein Projekt von André Heller.
Mehr zu den teilnehmenden Nationen in oe1.ORF.at
Tipp
Die insgesamt sechs Hefte kosten jeweils EUR 9,90 und sind gegen Ersatz der Versandkosten unter anderem über die Agentur Artevent zu beziehen. E-Mail
Links
Deutschland 2006
FIFA Worldcup
artevent.at