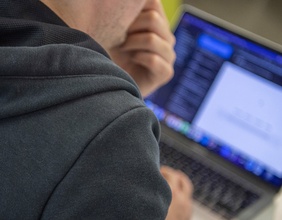Die Kultur des Verlierens - Teil 2
Die siegreiche Niederlage
Für Niederlagen gilt der gleiche Effekt wie für Gegentore - nur der Rhythmus verändert sich, das Ab und Auf wird weiträumiger. Auch Niederlagen können nützlich sein. Es kommt immer darauf an, was man aus einer Niederlage macht.
8. April 2017, 21:58
Der österreichische Schriftsteller Hermann Broch entwarf eine autobiographische Skizze, der er den Titel "Siegreiche Niederlage" gab; damit ist die größere, existentielle Dimension des Themas angedeutet. Aber siegreiche Niederlagen gibt es auch im Sport. Es kommt immer darauf an, was man aus einer Niederlage macht.
Der Tübinger Sportspsychologe Hartmut Gabler hat ein eingängiges Bild für den richtigen Umgang mit Niederlagen gefunden: Sie sollten verarbeitet werden in einer Schiffschaukelbewegung - das heißt der (von Zeit zu Zeit unvermeidliche) Absturz sollte noch während der Talfahrt zu neuem Schwung genutzt werden, der nach oben trägt. Das gelingt nicht immer - schließlich bedeutet im Nullsummenspiel sportlicher Wettkämpfe Gewinn auf der einen immer Verlust auf der anderen Seite. Aber wo es gelingt, vermag der Schwung manchmal weiter nach oben zu tragen als bis zum früheren Scheitelpunkt.
Auch nach außen gehen von Gegentoren, von misslungenen Versuchen, von einem vorübergehenden Abschwung nicht nur negative Botschaften aus. Es gibt ja nicht nur den Bandwagon-Effekt, der die Massen auf die Seite der triumphierenden Sieger treibt, sondern auch den Underdog-Effekt, die sympathisierende Begleitung der Schwächeren, der Verlierer oder wahrscheinlichen Verlierer.
Eine besonders starke Wirkung ist allerdings dort zu verzeichnen, wo der erwartete Verlust nicht eintritt. In David-Goliath-Konstellationen, wie sie etwa im Pokalwettbewerb der Fußballer zustande kommen, ist dies gut zu verfolgen: jahrelang zehrt man in der Heimat kleinerer Vereine von einem Überraschungssieg, der einmal gegen einen Großen errungen wurde.
Sieger, Sieg, Schiffschaukel nach oben - die ganzen Überlegungen über das Verlieren scheinen auf Umwegen unweigerlich wieder bei der Siegesdynamik zu landen. Ohne sie ist Sport nicht denkbar. Aber es ist eine Verkürzung, wenn man Niederlagen nur als Sprungbrett für künftige Siege interpretiert.
Sport wird gelegentlich als reiner Ausdruck der Leistungsgesellschaft betrachtet; aber er spiegelt auch die Entwicklung von der Leistungs- zur Erfolgshierachie, welche die Relativität von Leistung leicht vergessen lässt. Wo der Sieg auf dem Spielfeld absolutes Prinzip ist, verlängert sich die Feindschaftskonstellation des Wettkampfs leicht in die Gesellschaft hinein.
Der große George Orwell kam auf Grund von Beobachtungen im internationalen Fußball zu der Feststellung, "dass Sport ein unfehlbarer Grund für Feindschaft ist". Die Beispiele, die er anführt, könnten leicht durch solche aus der Gegenwart ergänzt werden. Aber ist diese Verlängerung von Gegnerschaft auf dem Spielfeld in gesellschaftlichen Hass ein im Sport liegendes Prinzip?
In Kolumbien, in Medellin, also im Zentrum von Armut und Kriminalität, läuft seit mehreren Jahren das Projekt eines Absolventen der Sporthochschule Köln, in dem Jugendliche über Fußball lernen, sich gegenseitig anzuerkennen - und sie lassen sich darauf ein, weil sie wissen, dass sonst auch das Spiel kaputt geht.
Allerdings hat die Leibeserziehung (ich verwende absichtlich diesen altväterlichen Begriff) lange den Akzent auf unerbittliche Härte, auf Kampf gelegt. Fußball spielte dabei eine prominente Rolle, und zwar - so hat es der Tübinger Turnlehrer Paul Sturm ausgedrückt - "wegen seines starken Zugs zum Nahkampf, der zu Angriff, Abwehr und Selbsthilfe führt und einen höheren Grad von Mannheit als irgendein anderes Spiel bedingt."
Das Bild des Nahkampfs lässt aufhorchen, und es nützt nicht viel, wenn man mit dem Weichzeichner drüber geht. Das Streben nach dem Sieg, der Kampf, ist Bedingung des Spiels. Aber der Sieg um jeden Preis, auch um den Preis der Schädigung des Gegners, ist kein erstrebenswertes Ziel.
Dass die Gegner Gegen-Spieler sind und dass der Rahmen des Spiels einschließlich der Regeln für alle gleich ist, sollte auch im Spiel bewusst bleiben. Und man kann schon fragen, warum aus dem vertrauten "Elf Freunde wollen wir sein" nicht grundsätzlich zweiundzwanzig Freunde werden können, die gleichzeitig Gegner und Partner sind.
Dieser Text entstammt einer Kooperation mit "Anstoss", der Zeitschrift des Kunst- und Kulturprogramms zur FIFA WM 2006; ein Projekt von André Heller.
Mehr zu den teilnehmenden Nationen in oe1.ORF.at
Tipp
Die insgesamt sechs Hefte kosten jeweils EUR 9,90 und sind gegen Ersatz der Versandkosten unter anderem über die Agentur Artevent zu beziehen. E-Mail
Links
Deutschland 2006
FIFA Worldcup
artevent.at