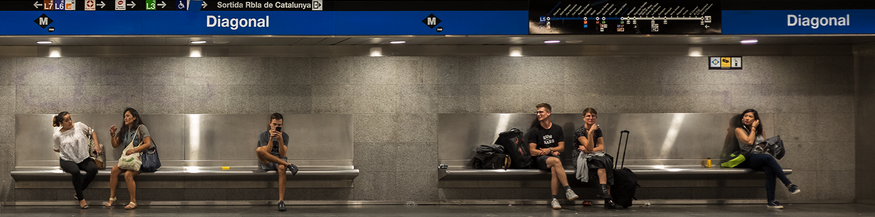Von Lingala über Soukous zum Buena-Vista-Phänomen
Tscha Tscha Tscha De Mi Amor
Die Geschichte der kongolesischen Rumba ist lang und kompliziert; sie hat mehr Protagonisten als ein ausuferndes Shakespeare-Drama. Ihr eigentliches Markenzeichen ist Lingala, eine kongolesische Handelssprache, eine "Sprache, die sich selbst singt.
8. April 2017, 21:58
"Cooperation" mit Franco & Sam Mangwana
Der Einfluss kubanischer Musik war im Kongo schon immer sehr dominant, allerdings in einer afrikanisierten Form, in der auch Daumenklavier, Pedal Steel Guitar und Akkordeon zum Einsatz kamen. Die Ursprünge der "Rumba congolaise" entstanden allerdings aus einer kongolesischen Handelssprache Ende der 1930er Jahre. Knapp vor der Unabhängigkeit des Kongo/Zaire entwickelte sich die Blütezeit des Rumba, die bis weit in die postkoloniale Epoche hineinreicht.
Diese Glanzzeit von 1956 bis 1982 lebt auf der neuen CD "Golden Afrique 2" auf, die soeben im Label Network erschienen ist. Sie ist eine Mischung von weniger bekannten Interpreten mit etablierten Größen wie Franco Luambo Makiadi, Sam Mangwana, Camille Feruzi, Bike Nzanga, Ngoma, Dr. Nico oder Tabu Ley Rochereau.
Von den Anfängen
Die Pioniere der "Rumba congolaise" waren eigentlich Arbeitsmigranten, die in den 1930er Jahren in die Städte oder in Lager transferiert wurden, um den Mineraltreichtum des Landes auszubeuten. Daraus ergab sich ein neues soziales Gewebe, komponiert aus Leuten, die von ihren Familien und Stämmen getrennt waren. So entstand eine Art Lingua franca, ein Verständigungscode, eine - wenn man so will - kongolesische Handelssprache - Lingala genannt -, die sich auch in der Musik wiederspiegelte und zum eigentlichen Markenzeichen der Rumba wurde.
Mit der Zeit wurden die traditionellen Instrumente wie Ngoma- und Lokole-Trommeln, Zithern und Marimbas immer stärker durch die Gitarre und - man höre und staune - das Akkordeon - ersetzt. Erste Figur, die sich aus den Nebeln der Vergangenheit schälte, war dann auch der Akkordeonspieler Camille Feruzzi aus Stanleyville, der mit seinem Quartett seit den späten 1930er Jahren das Nightlife der ehemaligen Hauptstadt von Belgisch-Kongo, Leopoldville, aufmischte.
Der Beginn des goldenen Zeitalters
Die Blütezeit der "Rumba congolaise" begann Mitte der 1950er Jahre, als die Single mit 45 Umdrehungen pro Minute den Plattenmarkt eroberte. Da sich im Laufe der Zeit viele Protagonisten auf dem Rumba-Markt verkauften, ist es überaus schwer, hier den Überblick zu behalten.
Eine besonders ergiebige Talentschmiede war jedenfalls das Orchester African Jazz, geleitet von Joseph Kabasele, der auch als Grand Kalle bekannt war. Er gilt als "Vater der kongolesischen Rumba". In seiner Band wirkten der Gitarrensuperstar Dr. Nico, der Soul-Makossa-Mann Manu Dibango aus Kamerun und die Sänger Tabu Ley Rochereau und Sam Mangwana mit. Seinen Durcbruch feierte Kabasele 1953 - drei Jahre, bevor der ungekrönte "König des Rumba", Franco Luambo Makiadi, auftauchte. Joseph Kabasele hatte dennoch gegenüber Franco in einem Punkt die Nase vorn: Im Jahr 1960 produzierte er den "Independence Cha Cha Cha" - ein Lied, das zur inoffiziellen Hymne der gerade errungenen Unabhängigkeit wurde.
Du kommst o. k. herein, du gehst k. o hinaus
Franco Luambo Makiadi hingegen, der bereits 1989 verstarb, wurde während seines Wirkens von den Kritikern mit unzähligen Prädikaten geschmückt: Le Tout-Puissant - der Allmächtige, der Hexer der Gitarre, der Großmeister oder Pate und Koloss der kongolesischen Musik. Bevor er mit seiner Monumentalband OK Jazz die Tanzsäle zum Kochen brachte, skandierte er seinen Wahlspruch ins Mikrofon: "Du kommst o. k. herein, du gehst k. o. heraus".
Der eher ungraziös wirkende Gitarren-Koloss zupfte seine Gitarre mit Fingern wie Adlerkrallen; er schrieb auch ein Musikmagazin: "Viele Leute glauben, dass sie in unserer Musik einen Latin Sound hören", sagte einmal: "Vielleicht denken sie dabei an die Bläser. Aber die Bläser spielen nur Gesangslinien. Die Melodie folgt der Tonalität der Lingala-Sprache; die Gitarrenparts sind afrikanisch und der Rumba-Rhythmus ebenfalls". Sein langjähriger Leadsänger, Sam Mangwana sagte einmal über Franco: "Er war einzigartig - wie Shakespeare und Mozart, kombiniert mit Pele und Muhammad Ali". Mit ihm entstand in den 1950er Jahren auch das in "Golden Afrique 2" enthaltene "Tscha Tscha Tscha De Mi Amor".
Yin und Yang auf engstem Raum
Wenn man vom damaligen Kongo spricht, meint man eigentlich zwei Länder: den ehemaligen Französisch-Kongo mit der Hauptstadt Brazaville und den viel größeren Belgisch-Kongo mit seiner Kapitale Leopoldville, später Kinshasa. Brazaville hatte eher das Image einer verschlafenen französischen Provinzstadt; Kinshasa galt als die frivole, aufregende Metropole, in der immer Saturday Night Fever herrschte. Dies kam auch bei den jeweils dort lebenden Musikern zum Ausdruck.
Eine Brazaville-Spezialität war beispielsweise das Orchester Likembe Geant. Die Musik dieser Band basierte auf der Likembe, einem Lamellophon oder - anders gesagt - einer Art Daumenklavier, das dem Sound eine metallische Durchschlagskraft verleiht. Bekannter Interpret dieses Orchesters war Bika Nzanga, der einen Sound entwickelte, der als Blaupause der elektrisch verstärkten Congotronics-Musik gelten kann, die erst im vergangenen Jahr weltweit für Furore sorgte.
"Gitarrengott" Dr. Nico
Ein Streiflicht in der Glanzzeit des "Rumba congolaise" sollte auch noch auf Dr. Nico gerichtet werden - den "Gitarrengott" und einzigen Herausforderer Francos an den sechs Saiten. Er veranstaltete quasi als "Erster Offizier von Grand Kalle" viele Jahre lang akustischen Feuerzauber.
Nico war ein Mann der weichen, fließenden Sounds im Gegensatz zu Francos harter, zuschnappender Attacke. Er spielte auch Hawaiigitarre und Pedal Steel und kreierte seltsame Musik-Bastarde, die man als Afro-Country bezeichnen könnte.
Musik im heutigen Kongo
Hat die erfolgreiche Weltmusikserie "Golden Afrique 2" zur Gänze den heroischen Klängen der Pioniere von der Rumbafront gewidmet, ist die Musik im heutigen Kongo - ehemals Zaire - schon wieder ganz woanders. Auf die Rumba folgte nahtlos der so genannte "Soukous", der mit unzähligen Billigproduktionen aus Paris schnell zum austauschbaren Fließband-Sound wurde.
Der Modefreak Papa Wemba, Koffi Olomide und Kanda Bongo Man sind zwar große pan-afrikanische Stars, doch ihre Musik hat die Innovationskraft einer Amöbe, von den Nachfolge-Generationen ganz zu schweigen. Dennoch: Seit einigen Jahren gibt es im Kongo ein kleines Buena-Vista-Phänomen: Veteranen der 1960er Jahre wie eben Sam Mangwana, Papa Noel oder Dr. Nico treten mit neuen Platten an die Öffentlichkeit und schwenken das Banner der klassischen Klänge.
Auch die Veteranentruppe Kekele räumt auf den Womex-Bühnen dieser Welt gewaltig ab. Ebenso Comeback-Time ist für einen Mann, der schon immer seinen eigenen Weg gegangen ist: Mose Fan Fan, der einst in Francos Gitarren-Armada diente und dann als Musik-Nomade die ganze Welt bereiste. Er ließ schon immer überflüssige Modernismen wie Drum-Maschinen und Synthesizer draußen. Bei ihm ist wie in einer Nussschale die zentrale Botschaft der kongolesischen Rumba geborgen: ein - wie Graeme Ewens schreibt - "musikalisches Grundnahrungsmittel, das Sentimentalität und Gefühlsexzess mit der unwiderstehlichen Euphorie der Rhythmen verbindet".
Hör-Tipp
Spielräume Spezial, Sonntag, 12. Februar 2006, 17:10 Uhr
Mehr dazu in Ö1 Programm
Link
Kongo-Kinshasa - geschichtlicher Überblick