Zum 150. Todestag von Heinrich Heine - Teil 4
Heine - der Kämpfer
"Bemerken muss ich, dass meine poetischen wie meine politischen, theologischen und philosophischen Schriften aus einem Gedanken entwachsen sind", notierte Heinrich Heine. Dieser Gedanke ist die Emanzipation des Menschen.
8. April 2017, 21:58
Im Verlauf der 1840er Jahre radikalisierte sich das Denken von Heinrich Heine. Er zählte zu den Schriftstellern, die sich eingehend mit den sozialen Folgen der Industriellen Revolution beschäftigte. Ähnlich wie die heutige Globalisierung zerstörte der Frühkapitalismus soziale Standards; wichtig war nur mehr das Zinsen tragende Kapital.
"Die schlesischen Weber"
Heine thematisierte auch das Elend des neu entstandenen Proletariats, wie es im Gedicht "Die schlesischen Weber" eindrucksvoll beschrieben wird. Das als Weberlied bekannte Gedicht wurde in Deutschland verboten; die Rezitation gar mit einer Haftstrafe belegt.
Trotz seiner freundschaftlichen Beziehung zu Karl Marx verstand sich Heine keineswegs als Marxist. Er setzte sich zwar für die Verbesserung der sozialen Lage des Proletariats ein, fürchtete aber die Gleichmacherei, die besonders für die Kunst Schlimmes befürchten ließ.
"Deutschland. Ein Wintermärchen"
In dem1844 publizierten Versepos "Deutschland. Ein Wintermärchen" schilderte Heine seine Eindrücke der ersten Reise nach Deutschland, die er seit seinem 12jährigen Aufenthalt in Paris unternommen hatte.
Es war dies eine Mischung von Reisebericht, ironischem Kommentar der deutschen Verhältnisse und der Sehnsucht nach einer besseren Welt, die nicht länger von der preußischen Reaktion und dem klerikalen Machtdünkel beherrscht wird.
"Atta Troll"
Seinen künstlerischen Protest gegen eine politische Kunst, die sich nicht an den Kriterien künstlerischer Qualität orientiert, sondern bloße Agitation darstellt, artikulierte Heine in seinem 1844 publizierten Versdrama "Atta Troll".
Es ist diese eine Tiererzählung, deren Held der Tanzbär Atta Troll ist. Der Tanzbär entflieht ins Gebirge und muss seine Gemahlin Mumma zurücklassen. Er kehrt zu seinen Jungen in eine Höhle zurück, wo er den Kleinen aufrührerische Reden gegen die Vorherrschaft des Menschen hält.
In den Reden des Bären finden sich Aussagen von zeitgenössischen Schriftstellern, die Heine zwar inhaltlich unterstützt, formal aber für misslungen hielt. Atta Troll ist somit eine Parodie des gutwilligen Agitators, der jedoch mit stumpfen Waffen kämpft.
Stumpf wurde auch der Kampf der revolutionären Kräfte nach der Revolution von 1848. Ähnlich wie nach der Revolution von 1830 setzten sich wieder die Kräfte der Restauration durch, von denen sich Heine distanzierte.
Schwere Erkrankung
Im Revolutionsjahr1848 erlitt Heine einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch, der sich schon lange angekündigt hatte. Lähmungssymptome, Kopfschmerzen und die Beeinträchtigung der Sehkraft machten ihn zu schaffen. Er selbst war davon überzeugt, an der Syphilis zu leiden, andere Diagnosen lauteten auf multiple Sklerose oder eine neurologische Erkrankung.
Gegen die unerträglichen Schmerzen wurde ihm Morphium verabreicht; er konnte nicht mehr gehen. Nach eigener Auskunft fühlten sich die Beine wie Baumwolle an und er musste wie ein Kind getragen werden. Der dramatische Verlauf der Krankheit fesselte Heine nunmehr an ein Bettlager - die "Matratzengruft", wie er es ironisch nannte und in dem er rund acht Jahre verbrachte. Heines produktive Schaffenskraft war dadurch keineswegs beeinträchtigt.
Hinwendung zur Religion
Da er nicht mehr schreiben konnte, diktierte er seine Schriften einem Sekretär. So kam es noch zur 1851 zur Veröffentlichung des Gedichtbandes "Romanzero". 1854 erschien sein politisches Vermächtnis "Lutetia" - eine Sammlung verschiedener Aufsätze über die Zustände in Frankreich.
Der Zusammenbruch der Gesundheit und der politischen Hoffnungen führten zu einer Neubesinnung; Heine wandte sich nun der Religion zu - die er in seinen Gedichten und Prosaschriften früher bekämpft hatte. Er entsagte "seinem philosophischen Stolz und glaubte an einen Einzigen und Ewigen Gott", dessen Gnade er für sich erflehte.
Am 17. Februar 1856 verstarb Heine aus Schwäche nach einem Blutsturz; am 20. Februar wurde er auf dem Pariser Friedhof Montmartre begraben.
Mehr zu Heinrich Heine in oe1.ORF.at:
Das Herz des Dichters
Heine - der freie Geist
Heine und Frankreich
Mehr zu Heinrich Heine in Ö1 Inforadio
Hör-Tipps
Von Tag zu Tag, Freitag, 17. Februar 2006, 14:05 Uhr
Gedanken für den Tag, Samstag, 18. Februar 2006, 6:57 Uhr
Du holde Kunst, Sonntag, 19. Februar 2006, 8:15 Uhr
Apropos Musik, Sonntag, 19. Februar 2006, 15:05 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendereihe "Radiokolleg" gesammelt jeweils am Donnerstag nach Ende der Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Buch-Tipps
Heinrich Heine, "Sämtliche Gedichte in einem Band", Insel, ISBN 3458172750
Heinrich Heine, "Deutschland. Ein Wintermärchen", dtv, ISBN 3423026324
Heinrich Heine, "Das Buch der Lieder", Anaconda, ISBN 3938484489
Jan-Christoph Hauschild, "Heinrich Heine", dtv Band 3
Jan-Christoph Hauschild/Michael Werner: "Heinrich Heine", dtv, ISBN 3423310588
Bernd Kortländer, "Heinrich Heine", Reclam, ISBN 3150176387
Joseph A. Kruse, "Heinrich Heine. Leben. Werk. Wirkung.", Suhrkamp Basis Biographie, ISBN 3518182072
Christian Liedtke, "Heinrich Heine", Rowohlts Monographien, ISBN 3499506858
Ludwig Marcuse, "Heinrich Heine Melancholiker, Streiter in Marx, Epikureer", Diogenes, ISBN 3257065051
Ralf Schnell, "Heinrich Heine zur Einführung", Junius Verlag, ISBN 388506930

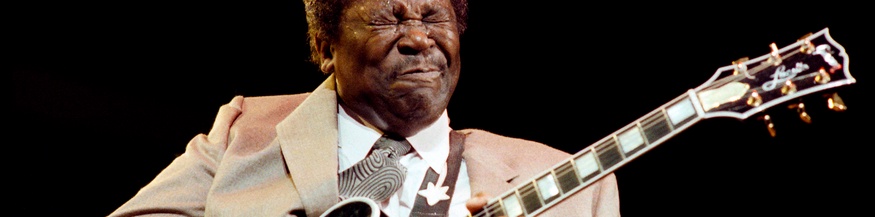

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DEED.DE|CC BY-SA 2.0] Ars Electronica Festival: Impressionen - Postcity](/i/related_content/be/0a/be0abe435ba816d5ee6c654aa7fcd6f770f4134e.jpg)
