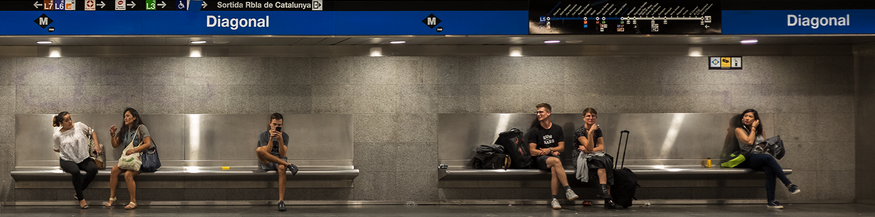Berührungspunkte zwischen Literatur und Wissenschaft
Science and Fiction - Teil 3
Die Naturwissenschaft übte immer eine Faszination auf Schriftsteller aus. Viele Dichter betätigten sich als Forscher. Neuerdings werden allerdings Literaten als Experten für wissenschaftliche Themen gehandelt - oder wollen zumindest so gesehen werden.
8. April 2017, 21:58
Michael Crichton ist gründlich. Der US-Amerikaner hat alle Studien über die globale Erderwärmung, über den Temperaturanstieg, die Gletscherschmelze und den Meeresspiegelanstieg gelesen. Erst dann machte er sich daran, sein Buch "Welt in Angst" zu schreiben.
Michael Crichton ist Schriftsteller. Wenn man ihn allerdings bei der Pressekonferenz zu seinem Buch "Welt in Angst" hörte, möchte man meinen, dieser Mann ist der Top-Experte unter den Klimaexperten. Und er wird auch als solcher angehört.
Autoren als Experten
Crichtons Konzept ist äußerst erfolgreich. Er schreibt Fiction vor einem wissenschaftlichen Hintergrund. In "Jurassic Park" ging es um Gentechnik und die Erweckung von Dinosauriern, in "Beute" um Nanotechnologie, die sich gegen den Menschen richtet.
Crichton ist der neue Typus des Experten. Vor 30 Jahren wären es noch die Spezialforscher gewesen, heute seien es jene, die Zusammenhänge herstellen und für ein breites Publikum aufbereiten könnten, meint Thomas Macho, Professor für Kulturgeschichte in Berlin und Autor des Buches "Science & Fiction".
Die Suche nach der Urpflanze
Die Wissenschaft ist seit Jahrhunderten als Stofflieferant für Literaten interessant. Goethes Wanderjahre zum Beispiel sind eine Fundgrube der naturwissenschaftlichen Themen seiner Zeit: der Astronomie, der Mathematik oder der Chemie um 1800. Johann Wolfgang von Goethe arbeitete naturwissenschaftlich. Er suchte in Italien die Urpflanze, die Farbenlehre bezeichnete Goethe selbst als sein Hauptwerk.
Forscher Strindberg
Goethe war ein Wegbereiter für Schriftsteller wie August Strindberg. Strindberg wandte sich im 1890 von der Literatur ab - er sagte, er habe sich leer geschrieben - und wollte sich von nun an der höher stehenden Naturwissenschaft zuwenden.
Es gab nichts, was ihn nicht interessiert hätte: die Zoologie, die Botanik, die Elektrizität, die Optik - oder die Chemie. Im autobiografischen Roman "Inferno" experimentiert der Erzähler im Labor. Strindberg wollte mit seiner eigenen Forschung die Lehre der Elemente auf den Kopf stellen, die Wissenschafter beeindrucken, sagt Thomas Fechner-Smarsly im Buch "Kultur im Experiment" (Kadmos Verlag). Strindberg kam in der Wissenschaft zu interessanten Beobachtungen, aber er revolutionierte das Denken nicht.
"Ego" als Faszinosum
Vielleicht ist das auch der schwierigere Weg als umgekehrt. Es gibt einige Wissenschafter, die in der Literatur Erfolge feierten: der Chemiker Bruno Levi zum Beispiel oder der Ingenieur Robert Musil.
Der bekannteste Wissenschafter, der eine zweite Karriere als Literat startete, ist Carl Djerassi, der Erfinder der Pille, ein Chemiker mit mehr als 1.200 Publikationen. Als er 1985, im Alter von 62 Jahren, an Krebs erkrankte, sattelte er um und begann sein neues Leben als Schriftsteller. "50 Jahre lang durfte ich das Wort 'Ich' nicht benutzen. Das ist als Wissenschafter nicht erlaubt", so Djerassi. Die Akkumulation dessen findet sich im Titel seines Romanes: "Ego".
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendungen der Woche gesammelt jeweils am Donnerstag nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Buch-Tipps
Michael Crichton, "Welt in Angst", Carl Blessing Verlag, ISBN 389667210
Carl Djerassi, "Ego", Haymon Verlag, ISBN 3852184487
Schmidgen, Geimer, Dierig (Hrsg.), "Kultur im Experiment", Kadmos Verlag, ISBN 3931659666
Safia Azzouni, "Kunst als praktische Wissenschaft", Böhlau Verlag 2005, ISBN 3412177040
Christoph Hoffmann, "Der Dichter am Apparat : Medientechnik, Experimentalpsychologie und Texte Robert Musils 1899 - 1942", Wilhelm Fink Verlag, ISBN 3770531809
Thomas Macho, Annette Wunschel, "Science & Fiction", Fischer Taschenbuch-Verlag, ISBN 3596158389