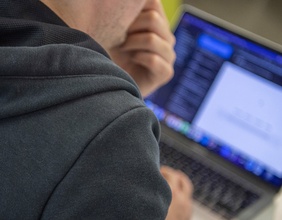Die Zeit, Schinnerl und ich
Beautiful Losers - Teil 5
Es ist seltsam, sagt Schinnerl, die Gegenwart, in der wir leben, ist jene Zeit, die wir uns in der Vergangenheit als Zukunft ausgemalt haben. Aber es hat sich nichts verändert. Die Zukunft ist nur die Verlängerung der Vergangenheit.
8. April 2017, 21:58
Schinnerl ist Ingenieur und hat gerade als Romancier debütiert, mit fünfundvierzig Jahren. Das ist nach Peter-Handkescher Zeitrechnung zwanzig Jahre zu spät, um als Dichter ernst genommen zu werden. Nach Wolfgang-Bauerscher Zeitrechnung müsste er seit fünf Jahren bereits tot sein, der wahre Dichter stirbt mit vierzig.
Eigentlich bedeutet das, dass immer Gegenwart ist, sinniert Schinnerl. Alles was ist, ist schon immer gewesen.
Schinnerl mag vielleicht kein Dichter sein, aber ein Schriftsteller ist er allemal. Ein guter noch dazu.
Sie haben schon Recht, sage ich. Jetzt sind wir genau so alt wie seinerzeit die Leute, über die wir vor einem Vierteljahrhundert hergezogen sind und von denen wir uns erwartet haben, sie ruhten sanft, wenn wir einmal in der Zukunft angekommen sind.
So haben wir unsere Zukunft hinter uns gebracht und erleben die Gegenwart als Hölle der Wiederholung, klagt Schinnerl und bekommt feuchte Augen. Er bestellt noch eine Flasche Sauvignon blanc.
Der Wirt, sage ich, um zu beweisen, dass es im Leben doch Veränderung geben kann, war einmal Leiter des Verlags der Akademie der Wissenschaften. Jetzt macht er vor der Kulturschickeria den Diener und muss auf den Toiletten allabendlich die Spuren tilgen, die diese hinterlässt.
Aha, murmelt Schinnerl und scheint seine Gedanken über den Lauf der Zeit neu zu ordnen.
Dort zum Beispiel, sage ich und deute mit dem Kopf zur Theke, dort sitzt der Schriftsteller Wondratschek, der auch schon einmal bessere Tage erlebt hat. Und da - ich deute die Bewegung durch den Raum mit tanzenden Augenbrauen an - lässt der Chefredakteur Sperl den Tag ausklingen, ein Mann der katholischen Provinz, auch der medialen, der im gegenwärtigen Österreich als linksliberaler Intellektueller durchgeht. Das sagt viel über die geistige Verfassung des Landes aus.
Utopien sind Utopie, sagt Schinnerl, und Hoffnung auf Veränderung der größte Fehler, davon bin ich überzeugt. Veränderung fordern immer nur die ein, die persönlich kein Interesse daran haben. Damit halten sie sich all jene vom Leib, die an Veränderung glauben, an Wachstum, an Wohlstand, an das ökologische Gleichgewicht, an die friedliche Nutzung der Atomenergie, an den Versöhnungsfonds und an angekündigte Steuererleichterungen.
Schinnerl erzählt, er habe keine Utopien mehr, deshalb habe er ja angefangen zu schreiben. Er habe täglich geschrieben, über Jahre hinweg. Er habe sich auf Tausenden Seiten ein Leben zurechtgeschrieben, das nur aus Vergangenheit besteht, aus Gewesenem und nie Gewordenem. Jetzt, sagt er, sei er Schriftsteller, und alles, was er schreibe, sei bereits gedacht, und alles, was gedacht sei, sei auch schon längst verloren. Als Schriftsteller habe man sich jede Utopie zu versagen.
Wie wird man eigentlich Kritiker, will Schinnerl wissen, während der ehemalige Leiter des Verlags der Akademie der Wissenschaften mit ausdruckslosem Gesicht die Flasche entkorkt. Jemand lacht hysterisch, als hätte er die Frage gehört.
Aus demselben Grund, warum man Minister einer Partei wird, die niemand gewählt hat, sage ich. Weil man es sich nicht aussuchen kann, weil man nichts gelernt hat, weil man ein Überzeugungstäter ist, weil man eine Rampensau ist und gern in der Öffentlichkeit steht, weil man im beruflichen Abseits steht und auf ein Leben nach der Depression hofft, weil man bankrott oder ständig betrunken ist. Deshalb.
Aha, murmelt Schinnerl wieder. Möglicherweise wägt er ab, was das für sein Buch bedeuten könnte. Er nimmt einen Schluck vom Sauvignon blanc und lässt ihn eine Zeit lang in seiner Mundhöhle lagern, ehe er ihn durch die Kehle abrinnen lässt. Drei junge Männer betreten lachend das Lokal, setzen sich an den letzten freien Tisch und stimmen ein Kärntnerlied an.
Schaut heute noch der Führer vorbei, will Wondratschek wissen. Lachen, verständnislose Blicke, Kopfschütteln. Die Männer lassen sich dadurch aber nicht bei der Ausübung ihrer angestammten Kultur beirren.
Traurig, irgendwie, klagt Schinnerl. Ich habe ein Buch geschrieben und bin dabei alt geworden, und es ist doch so, als hätte ich es nie geschrieben, weil sich in dieser langen Zeit nichts verändert hat. Auch mein Buch wird nichts verändern.
Schinnerl hat Recht. Sein Buch wird nichts verändern. Gar kein Buch wird etwas verändern. Auch das Lokal, sagt er, vermittelt doch den Anschein eines Wirtshauses aus der Zeit der Ersten Republik. Es riecht nach abgestandener Zeit. Die drei Sänger von der Blutgrenze tun das Ihre dazu.
In Wirklichkeit handelt es sich um eine Art Wunderkammer für ein zahlungskräftiges konservatives Publikum, wende ich ein. Der Trick ist, dass sich im ständestaatlichen Ambiente - die schwarzen Herren tafeln in der warmen Stube, die roten Knechte fressen im Hof die rohen Kartoffeln, und die braunen Lausbuben schauen zum Fenster herein - zu äußerst gegenwärtigen Preisen ein trefflicher Abend unter Gleichgesinnten verbringen lässt. Das nennt man dann Kultur.
Ja, begeistert sich Schinnerl, und ein wenig schwitzt man den Geruch des Widerstands aus, denn die Stadt wird seit Menschengedenken von den Roten regiert. Man fühlt sich auf wagnerianische Weise elitär und missverstanden und drückt sein Unglück durch Kultiviertheit aus.
Weil, schraube ich meine Stimme in die Höhe, weil, mein Freund, der Kulturbetrieb ist ja schließlich nichts anderes als eine Nervenheilanstalt für die entmutigte Bourgeoisie.
Ja, stöhnt Schinnerl, wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht wohin...
Ein großer Mann mit gelocktem Haar und einem Koffer in der Hand betritt das Lokal. Die drei jungen Männer hören sofort auf zu singen, im ganzen Raum herrscht plötzlich Totenstille. Wondratschek kaut an den Fingernägeln, Sperl setzt das Bierglas an die Lippen und simuliert einen Anfall von akutem Durst.
Den hab ich schon einmal gesehen, flüstert Schinnerl.
Das ist der Dichter Schindel, sage ich und presse die Zähne zusammen, dass mir der Schweiß auf die Stirn tritt.
Wo, fragt Schindel den Wirt.
Da, sagt der Wirt und deutet mit dem Daumen auf mich.
Schindel kommt langsam auf unseren Tisch zu. Er hat keine Eile, er weiß, dass ich ihm nicht entkomme. Die Blicke sämtlicher Gäste kleben auf ihm. Wenige Zentimeter vor der Tischkante bleibt er stehen. Schinnerl, sagt Schinnerl und erhebt sich ein wenig von seinem Sessel. Schindel ignoriert ihn und sagt, dass es auch alle hören: Der Austrokoffer ist fertig, von einem Schinnerl hab ich noch nie etwas gehört!
Landvermessung, protestiere ich leise, der Austrokoffer heißt schon lange -
Wurscht!, fällt mir Schindel ins Wort. Österreich ist frei, das Wort ist es laut Verfassung auch und ich bin es sowieso.
Er wirft mir den Austrokoffer vor die Füße.
I bin so frei, und jetzt bin i dem Nenning nix mehr schuldig. Was drin is, waaß i net, i bin nur der Herausgeber. Schindel lacht. Alle lachen, ich auch. Nur Schinnerl schaut ratlos drein.
Ein Glasl rot für den Herrn Schindel?, fragt der Wirt.
Naa, glei zwa, ruft Schindel, für mi und für mi, weil wir zwa kumman seit längerem nimma zurecht miteinand. Zahlen tut der Kritiker! Schindel lacht. Alle lachen, ich auch. Dann dreht er sich um, schubst Wondratschek vom Hocker und setzt sich an die Theke.
Also, sage ich zu Schinnerl und klopfe ihm auf die Schulter, ich muss, ich muss. Arbeit wartet. Die Republik feiert und mit ihr die Dichter. Frag nicht, was Österreich für dich tun kann, frag lieber, was du für Österreich tun kannst, nicht wahr? Ihr Buch, mein Gutester, werde ich wohl nicht unterbringen. Das nächste Mal. Au revoir, Schinnerl, schreiben Sie weiter, aus ihnen wird noch etwas! Ich darf Ihr Gast sein, ja?
Schinnerl ist sprachlos. Ich verlasse das Lokal mit dem Koffer in der Hand. Der Griff ist noch feucht von Schindels Schweiß. Beinahe stolpere ich über Wondratschek. Früher, stöhnt er, begann der Tag mit einer Schusswunde. Kann hier jemand sauber machen, rufe ich dem Wirt zu. Manchmal ist es schön, mit seiner Arbeit den Bestand des geistigen Österreich zu sichern. Die Zukunft wird es mir danken.
Buch-Tipps
Sebastian Schinnerl, "Pluton oder Die letzte Reise ans Meer", Roman, Residenz Verlag, ISBN 3701714215
"Landvermessung", herausgegeben von Günther Nenning, Mitherausgeber: Milo Dor, Marie T. Kerschbaumer, Anna Mitgutsch, Robert Schindel, Julian Schutting, Residenz Verlag, ISBN 3701714282
Mehr dazu in oe1.ORF.at
Robert Schindel, "Wundwurzel", Gedichte, Suhrkamp Verlag, ISBN 3518417053
Wolf Wondratschek, "Saint Tropez", Erzählungen, Hanser Verlag, ISBN 3446206663
Gerfried Sperl, "Steiermark. Die knappe Geschichte eines üppigen Landes", Ueberreuter Verlag, ISBN 3800071290