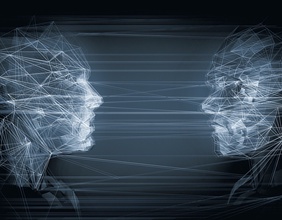Tabuthema Frau
Eine seltsame Frau
Leyla Erbils erster Roman thematisiert die Rolle der Frau in der islamischen Gesellschaft. Wie die Autorin selbst, sucht die Protagonistin intellektuelle Anerkennung, die ihr immer wieder verweigert wird. Letzten Endes bleibt nur die Hoffnung.
8. April 2017, 21:58
Leyla Erbil wurde 1931 geboren. Acht Jahre zuvor - 1923 - hatte Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik ausgerufen, zu deren ideologischen Grundpfeilern der Laizismus, also die strikte Trennung von Staat und Religion, gehört.
Kein Glück im Islam
"Abgesehen davon, dass in meinem Personalausweis steht 'Konfession: Islam', habe ich mit dem Islam nichts zu tun", erzählt Leyla Erbil. "Ich glaube an eine sozialistische Welt, ich glaube an den westlichen Humanismus. Aber ich glaube nicht an das so genannte grüne Glück, also das vom Islam verkündete Glück. Und daran muss man auch nicht glauben. Die gesamte islamische Welt ist rückständig. Man kann meine Generation auch als eine gottlose Generation bezeichnen", so Leyla Erbil.
"Mein Leben und Schreiben ist wie ein Pendel zwischen Agnostizismus und Mystizismus, und ich denke, vielleicht muss ich mich ja gar nicht für das eine oder andere entscheiden, vielleicht kann man beides zugleich sein", wünscht sie sich.
Wunsch nach einer gerechten Welt
Leyla Erbil setzt sich aber auch kritisch mit der türkischen Staatsideologie, dem so genannten Kemalismus, auseinander. "Als ich Ende der 1950er, Anfang 1960er Jahre anfing zu schreiben, da war die Lage der Frau und ganz generell die Lage der Menschen in unserer Gesellschaft ein Tabuthema", erzählt sie. "Ich hatte das Bedürfnis, mich gegen diese Tabus zur Wehr zu setzen, ich wollte in einer gerechten Welt leben. Als ich dann 'Eine seltsame Frau' verfasste, war ich schon überzeugte Sozialistin. Wir wollten die Welt verändern, wir hatten eine Utopie. In meinen Werken wollte ich zugleich die Lage der Frau thematisieren, ihre Identität."
Die türkischen Frauen hatten schon bald nach der Gründung der Republik zahlreiche Rechte erhalten. Die moderne türkische Frau sollte gebildet und berufstätig sein, zugleich aber sollte sie geschlechtsspezifisches Rollenverhalten und patriarchale Werte nicht in Frage stellen.
Rückständige Männer
Die linken intellektuellen Kreise, in denen Leyla Erbil verkehrte, thematisierten zwar die sozialen Ungerechtigkeiten, überkommene Ehr- und Moralbegriffe, unter denen insbesondere die Frauen zu leiden hatten, waren aber auch für sie kein Thema. Im Roman "Eine seltsame Frau" - übersetzt von Angelika Gillitz-Acar und Angelika Hoch - empört sich die Protagonistin Nermin über die türkischen Männer:
Jeder einzelne von ihnen brüstet sich zwar damit, Kemalist zu sein, aber es verträgt sich nicht mit ihrem männlichen Gehabe, wenn wir uns als Gleichberechtigte unter sie mischen. (...) Sie sind immer noch Osmanen. Osmanen? Nein, noch schlimmer als die alten Osmanen.
Der Osmane wird hier mit jener Traditionsgebundenheit und Rückständigkeit gleich gesetzt, unter der Nermin als moderne Frau ständig zu leiden hat. Auch Nermins streng gläubige Mutter vertritt die alten Ehrvorstellungen. Der Vater als Sufimystiker ist offener und toleranter, doch Nermin weist wie viele Türkinnen und Türken aus den ersten Republikgenerationen orthodoxe wie heterodoxe religiöse Strömungen von sich. Sie bekennt sich zum Sozialismus.
Unvollendete Modernisierung
Der Bruch mit der islamischen Vergangenheit spielt bei Leyla Erbil eine große Rolle. Doch er manifestiert sich als tiefes Unbehagen angesichts einer Modernisierung, die nicht vollendet wurde, sondern weiterhin belastet wird vom Erbe der osmanischen, patriarchalen und von der Religion geprägten Vergangenheit:
"Zweifelsohne hat man auch im Islam hohe philosophische Werte erreicht, in der Spiritualität und in der Mystik des Sufismus", meint sie. "Aber heute tun viele so, als würden sie diese Werte vertreten. Das ist alles inhaltslos geworden. Eine Mode."
Buch-Tipp
Leyla Erbil, "Eine seltsame Frau", Unionsverlag, ISBN 3293100015