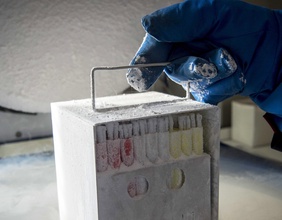Vom Duftkino zu Sensurround
Kino in fünf Dimensionen
Das Wiener IMAX-Kino wartet ab September mit einer neuen Attraktion auf: Ein eigenes "Duftkino" verspricht Blütendüfte oder sanfte Meeresbrisen. Solche Seitenwege ist die Filmgeschichte bereits öfter gegangen.
8. April 2017, 21:58
Ganz so neu, wie man jetzt tut, ist das Geruchskino auch wieder nicht: Es war in den erfindungsseligen späten 50er Jahren, als man zum ersten Mal begann, die Kinozuschauer nicht nur mit Bildern und Tönen, sondern auch mit gesteuerten Gerüchen zu traktieren. "Aroma-Rama" nannte sich das 1959 erfundene und nicht sonderlich langlebige Verfahren, das zum Film "Behind the Great Wall" passende Gerüche in die Klimaanlage des Kinos schickte.
Ein Jahr später erlebte das Verfahren in einer verbesserten Auflage namens "Smell-o-Vision" seine kaum nachhaltigere Weiterentwickelung. Trash-Papst John Waters schickte dem Geruchskino anno 1982 einen sarkastischen Abgesang hinterher: Sein Film "Polyester" lief in der Premierenfassung im "Odorama"-Verfahren: Die Zuschauer bekamen beim Eintritt Kartonkärtchen ausgehändigt, aus denen sie beim Erscheinen bestimmter Zahlen auf der Leinwand dann selbst die Gerüche frei zu rubbeln hatten. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es meist ununterscheidbar chemisch gestunken hat.
Der König der Gimmicks
Gegen den 1977 verstorbenen William Castle war John Waters freilich nur ein stümperhafter Amateur. Castle, der sich eigentlich als zweiter Hitchcock sah, ging in Wahrheit als König der (Kino-)Gimmicks in die Filmgeschichte ein. Unvergessen beim Film "Mörderisch" ("Homicidal",1961) die eingebaute "Schreckenspause": Kurz vor der Auflösung der (stark an "Psycho" orientierten) Mordgeschichte wurde es hell im Saal; wer zu diesem Zeitpunkt das Kino verließ, bekam sein Eintrittsgeld retour.
Stärkerer Castle-Tobak war freilich "Percepto", ein Gimmick, der zum ersten (und auch letzten) Mal beim Film "Schrei, wenn der Tingler kommt" ("The Tingler", 1959) zum Einsatz kam: In passend verkabelten Kinos begannen die Sitze bei den schrecklichsten Szenen des Films tatsächlich zu vibrieren - das spätere Sensurround-Verfahren, mit dem Hollywood einen ähnlichen Trick versuchte, war davon eigentlich nur ein kraftloser Abklatsch.
Immer wieder: 3D-Film
Dann gab es noch "Illusion-O", ein Verfahren, bei dem der Zuschauer ein rot-blaue Brille aufsetzen musste und, je nachdem, durch welches Glas er blickte, ein und die selbe Szene bald mit, bald ohne Geister-Erscheinung betrachten konnte. Die Brille führt uns zwanglos in die Welt des 3D-Films. Immer wieder versuchten findige Produzenten, sich gegen die vermeintliche Konkurrenz des Fernsehens mit der Ausweitung des Kinobildes in die 3. Dimension zu behaupten, und immer wieder erlosch die Begeisterung des Publikums bereits nach relativ kurzer Zeit. Zu eingeschränkt ist der ideale Blickwinkel im Kino, zu mühsam das Tragen der Brille, als dass sich 3D-Filme je hätten auf Dauer durchsetzen können.
Auch dem neue Anlauf des Geruchskinos wird kein nachhaltiger Erfolg beschieden sein. Wieso auch: Wenn der Film selbst zu fesseln vermag, reichen zwei Dimensionen und ein bequemer Kinosessel völlig aus.