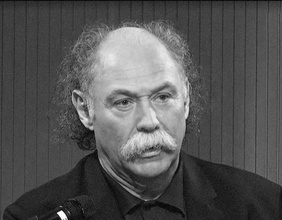Forschungsförderung kocht in der Espresso-Maschine
Brühen für die Wissenschaft
Kaffee regt an. Sicher auch so manche Forschungsfragen. Fragen nämlich abseits des Koffeins. Seien es nun Germanistik, Chemie, Biologie oder Astronomie - ohne Kaffee würden viele Entdeckungen und Entwicklungen auf sich warten lassen.
8. April 2017, 21:58
Wie viel Kaffee wohl in Forschungslabors getrunken wird? Zu wissenschaftlichen Zwecken. Nicht vordergründig, um eine charakteristische Röstung, ein nussige Note oder eine satte Crema nach reproduzierbaren und objektiven Parametern zu entwickeln. Sondern um den Forschergeist zu beflügeln, um wissenschaftliches Arbeiten grundsätzlich möglich zu machen.
Sei es nun die Suche nach Wasser auf dem Mars, die Entschlüsselung des Erbguts der Fruchtfliege oder die Analyse der romanischen Sprachfamilie. Jeder muss in Schwung kommen. Wie viele WissenschafterInnen wohl zur Tasse greifen?
Espresso, was sonst?
Wenn man von echtem Kaffee spricht, dann ist Espresso gemeint bzw. Mokka: 1,5 Gramm flüchtige Stoffe in 30 Milliliter Flüssigkeit. Vermutlich rinnen aber andere Kaffeevariationen literweise durch Papierfilter in den Teeküchen von Forschungslabors oder Studierstuben.
Der Gesundheit unter Umständen abträglich - hin oder her. (So wie viele Hautärzte auch gerne in der Sonne sitzen, manche Kardiologen übergewichtig sind oder einige Lungenfachärzte rauchen.) Kaffee regt an - Diskussionen, Ideen oder schlicht den Kreislauf. So gesehen brüht in der Espressomaschine die Forschungsförderung schlechthin.
Wissenschaftlich eindeutig bewiesen: Pro wie Contra
Natürlich wird auch über Kaffee selbst viel geforscht. Ein Nahrungsmittel an dem sich die Geister scheiden: Auswirkungen auf Nervensystem, Kreislauf, Herz oder Magen - stets sind Gegner samt Warnungen zu finden, aber auch Befürworter mit Entwarnungen. Cholesterin, Homocystein, Acrylamid, Bluthochdruck, Verdauung, Antioxidantien - Pro und Contra enden meist in der Empfehlung, nicht "zu viel" zu trinken.
Die Wirkung des Kaffees beruht auf der enthaltenen Menge Koffein. Der (für die meisten) anregende Effekt ist laut Ernährungswissenschaftern durch eine zweite Tasse nicht steigerbar.
Erst nach zwei bis drei Stunden lohne sich das neuerliche Brühen und Nippen, vorher spüre der Körper durch zusätzliches Koffein wenig Erfrischung. Für die Wirkung in Relation zur Menge sei aber nicht nur Gewohnheit (Suchtverhalten?) ausschlaggebend, sondern auch Körpergewicht und Mageninhalt.
Individuelle Langzeitstudien
Die entscheidende Studie wird dem Probanden selbst überlassen: Quantität und Qualität im Individualfall optimal bestimmen. Die Raffinesse besteht darin, dass ein einziger Kaffee pro Tag zum Schmetterlingsschlag wird; dass eine einzige Tasse als konzentrierter Impulsgeber reicht, um Gespräche anzuregen, Träume aufzuschäumen, Tatendrang zum Überkochen zu bringen.
Versuchsanordnung für perfekten caffè
Die hier vorgeschlagenen "Laborbedingungen" für das alltägliche Experiment sind Empfehlungen des italienischen Kaffeerösters Illy:
Sechs bis sieben Gramm des fein gemahlenen Pulvers werden in 25 bis 30 Sekunden bei einer Wassertemperatur von 90 bis 95 Grad Celsius unter Druck zum Espresso. Dabei sollte die Tasse auf 80 bis 85 Grad Celsius vorgeheizt worden sein. Nicht mehr als 30 Milliliter Wasser. Optimaler Druck: zwischen acht und zehn Atmosphären Überdruck.
Einen Parameter haben die Illy-Chemiker und Aromaforscher aus Triest verschwiegen: Größe und Anzahl der Poren im Metallfilter, über den das Wasser durch das Kaffeepulver gepresst wird. Um diese Wissenslücke zu füllen, habe ich mich zum Selbstexperiment entschlossen (nicht randomisiert, nicht doppel-blind, nicht Placebo-kontrolliert): Die unterschiedlichen Filtersiebe aus Metall meiner Espresso-Maschine werden bei Verkostungen auf ihre unterschiedliche Wirkung geprüft. Derzeitiger Stand: mehr Löcher = mehr Fülle und weniger Säure im Kaffee. Die Versuchsreihe ist allerdings noch nicht abgeschlossen.
Laborsituation: Aufregend anregend
1,3,7-Trimethylxanthin oder einfach Koffein - laut Pschyrembel (DEM klinischen Wörterbuch) weiße Kristallnadeln mit schwach bitterem Geschmack. Es beschleunige die Herztätigkeit nach vorangegangener Verlangsamung, wirke erregend auf Hirnrinde, Atemzentrum sowie Gefäßzentrum und - Vorsicht! - verringere die Gehirndurchblutung. Hm. Doch keine Forschungsförderung? Eher eine Forschungsbremse?
"CoSIC" (Coffee Science Information Center) spricht von der "most widely consumed pharmacologically active substance in the world". Koffein sei in 60 Pflanzenarten zu finden: in Kakaobohnen, den Blättern des Teestrauchs, den Samen des Kaffeebaumes, Mate oder Kola-Nuss. Vom Schluck bis zur Verdauung vergehen CoSIC zufolge 45 Minuten.
Modellfall für Genforschung und Ökonomie
Vor genau einem Jahr haben brasilianische Wissenschafter das Erbgut des Kaffees (arabica-Bohne) entziffert. Sie haben damals angekündigt, eine Datenbank mit 200.000 DNA-Abschnitten anzulegen. So werde es leichter, Schädlings-resistente Pflanzen zu züchten. Auch könnten Bohnen mit noch mehr Aroma gezüchtet werden.
Der Forschungserfolg ist Goldes wert: Kaffee ist nach Erdöl das zweitwichtigste Handelsprodukt. Global gesehen. Übrigens: Schnell noch einen Espresso bestellen, denn ab Juni wird eine Preissteigerung erwartet. Laut Österreichischem Kaffee- und Teeverband wird das Kilo Kaffee im Handel vermutlich um einen Euro teurer.
Die Rohkaffeepreise am Weltmarkt haben sich seit der zweiten Jahreshälfte 2004 zum Teil mehr als verdoppelt. Die heurige Ernte wird nämlich voraussichtlich knapp ausfallen: 107 Millionen Sack (à 60 Kilogramm) statt 114 Millionen Sack im Vorjahr. Trotz steigender Nachfrage. (Oder gerade deshalb?)
Koffein-Linguistik: Giannis Schani
In Wien bzw. Österreich ist Kaffee mit dem Namen Kolschitzky verbunden. Georg Franz Kolschitzky (geboren 1640 in Polen, gestorben 1694 in Wien) war Kaufmann, Kurier und Dolmetscher bei der Orientalischen Handelskompagnie in Belgrad. Wegen seiner Kundschafterdienste während der 2. Türkenbelagerung Wiens 1683 wurde er in den Rang eines kaiserlichen Dolmetschers erhoben.
Kolschitzky erhielt als einer der ersten das Privileg zur Kaffeeausschank in Wien und galt dadurch lange als Ahnherr des Wiener Kaffeehauses. In Geschichtsbüchern wiederum steht zu lesen, Kolschitzky habe nie ein Kaffeehaus betrieben.
Den ersten Wiener Schanigarten mit Tischen und Sesseln vor dem Kaffeehaus eröffnete um 1750 der Cafetier Gianni Tarroni am Graben nahe dem Stephansdom. Von "Giannis Garten" zeugt angeblich heute noch die Bezeichnung "Schanigarten".
So, und jetzt einen Espresso und weiter geforscht.