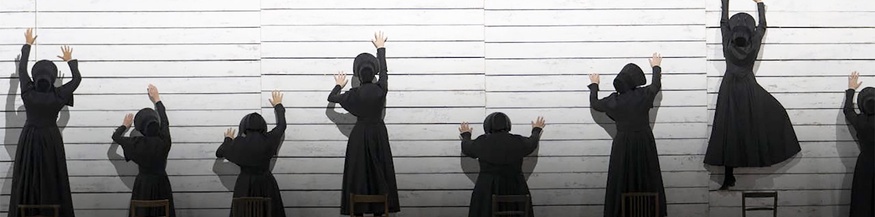Zum 90. Geburtstag von Billie Holiday
Lady sings the Blues
"Mum und Dad waren noch Kinder, als sie heirateten. Er war 18, sie war 16, und ich war drei". So beginnt Billie Holidays Autobiografie "Lady sings the Blues". Mit ihrem Song "Strange Fruit" erlangte "Lady Day", wie sie auch genannt wurde, Weltruhm.
8. April 2017, 21:58
Billie Holidays "Strange Fruit"
Am 7. April wäre sie 90 Jahre alt geworden: Eleonora Fagan Gough alias Billie Holiday, auch "Lady Day" genannt. Ein außergewöhnliches Leben, eine künstlerische Jahrhunderterscheinung. Keine hat den Blues gelebt, den Blues gesungen so wie sie.
Bluesie Billie
Mam und Dad waren noch Kinder, als sie heirateten. Er war 18, sie war 16 und ich war drei.
So beginnt ihre Autobiografie "Lady sings the Blues", 1957 bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen, als rororo Taschenbuch 1964.
Der Vater verlässt die Familie, als Billie noch ein kleines Kind ist, die Großmutter, zu der sie ein inniges Verhältnis hat, stirbt, als sie sechs Jahre alt ist. Mit zehn Jahren wird sie vergewaltigt, mit zwölf arbeitet sie als Putzhilfe im Bordell und hört fasziniert aus dem Grammofon Louis Armstrong spielen. Bereits im Alter von 15 Jahren beginnt sie in Clubs aufzutreten.
Café Society
Im Café Society erklang zum ersten Mal "Strange Fruit", das Lied gegen Lynchjustiz im Süden der USA. Dieses Café war ein Club der linken und liberalen Intellektuellen und der New Yorker Bohème im Greenwich Village. Obwohl überwiegend von Weißen besucht, fand sich doch ein gemischtes Publikum ein - es war der einzige New Yorker Club außerhalb Harlems, der überhaupt Weißen und Schwarzen gleichzeitig offen stand. Der Betreiber Barney Josephson war sowohl ein vehementer Anhänger der "Rassenintegration" wie von gutem Jazz und guter Unterhaltung.
Der Song zum Weltruhm
Als Billie Holiday "Strange Fruit" in ihr Repertoire aufnahm, war sie 24 Jahre alt und als Unterhaltungskünstlerin schon ein Begriff. Sie selbst war in ihrem Leben zahlreichen Formen des Rassismus ausgesetzt. Ihr Vater war 1937 gestorben, vor allem deshalb, weil sich alle Krankenhäuser der Gegend weigerten, einen Afroamerikaner zu behandeln. Sie selbst sagte dazu: "Nicht die Lungenentzündung tötete ihn, Dallas tötete ihn".
Der Song sticht auch im Repertoire Holidays heraus. Während sie sowohl als elegante Jazz-Sängerin wie auch als ausdrucksstarke Blues-Interpretin bekannt war, erreichte sie vor allem mit "Strange Fruit" Weltruhm. Das öffentliche Bild von Billie Holiday und der Song verschmolzen miteinander: Sie war nicht mehr nur die Frau, die ihr Publikum verführen und rühren konnte, sie war in der Lage es regelrecht zu erschüttern.
Der Komponist und Texter
Abel Meeropol war ein russisch-jüdischer Lehrer aus der Bronx und Mitglied der kommunistischen Partei der USA. Er sah ein Foto des Lynchmords an Thomas Shipp und Abram Smith, das ihn nach eigenen Aussagen für Tage verfolgte und nicht schlafen ließ. Daraufhin schrieb er das Gedicht "Bitter Fruit" und veröffentlichte es unter dem Pseudonym Lewis Allan im Magazin "New York Teacher" und der kommunistischen Zeitung "New Masses". Später schrieb er das Gedicht in den Song "Strange Fruit" um. Die Erstaufführung erfolgte durch Meeropols Frau bei einer Versammlung der New Yorker Lehrergewerkschaft.
"Strange Fruit" gewann eine gewisse Popularität innerhalb der US-amerikanischen Linken. Barney Josephson hörte davon und stellte Meeropol und Holiday einander vor. Obwohl Meeropol später noch andere Songs schrieb, darunter auch einen Hit für Frank Sinatra, hing sein Herz immer besonders an diesem Stück. Um so verletzter war er, als Billie Holiday in ihrer Autobiografie behauptete, dass "Strange Fruit" gemeinsam von ihr und ihrem Klavierspieler Sonny White geschrieben worden sei.
Ein Song und seine Wirkung
Neben "We Shall Overcome" und vielleicht noch Bob Dylans "The Murder of Emmett Till" ist kein anderes Lied derart mit dem politischen Kampf um schwarze Gleichberechtigung verwoben wie "Strange Fruit". Bei seiner Einführung noch als Schwarze Marseillaise gefeiert bzw. als Propagandastück bekämpft, wurde es im Laufe der Zeit immer mehr als überpolitisch wahrgenommen: als musikalische Einforderung der Menschenwürde und Gerechtigkeit.
Besonders einflussreich in der Rezeption war Angela Davis' Buch "Blues Legacies and Black Feminism". Während Holiday oft als "bloße Unterhaltungssängerin", die quasi als Medium für den Song diente, porträtiert wurde, zeichnete Davis auf dem Hintergrund ihrer Untersuchungen das Bild einer selbstbewussten Frau, die sich der Wirkung und des Inhalts von "Strange Fruit" sehr bewusst war. Sie interpretierte das Lied als maßgeblich für die Wiederbelebung der Tradition von Protest und Widerstand in der afroamerikanischen und US-amerikanischen Musik und Kultur.
Zum Song des 20. Jahrhunderts gekürt
Oft genug setzte Billie Holiday den Song gezielt ein. Obwohl er zu ihrem Standardrepertoire gehörte, variierte sie ihn wie keinen anderen in der Art der Vorführung.
Das "Time Magazine" bezeichnete "Strange Fruit" 1939 als musikalische Propaganda, kürte das Lied aber 60 Jahre später zum Song des 20. Jahrhunderts. "Strange Fruit" war lange Zeit in den USA im Radio unerwünscht. Die BBC weigerte sich anfangs, das Lied zu spielen Im südafrikanischen Radio war der Song in der Zeit der Apartheid offiziell verboten.
Hör-Tipp
Tonspuren, Sonntag, 18. Mai 2008, 21:15 Uhr
Links
CMG Worldwide - Billie Holiday
musicline.de - dt. Biografie und Diskografie
Billie Holiday Net