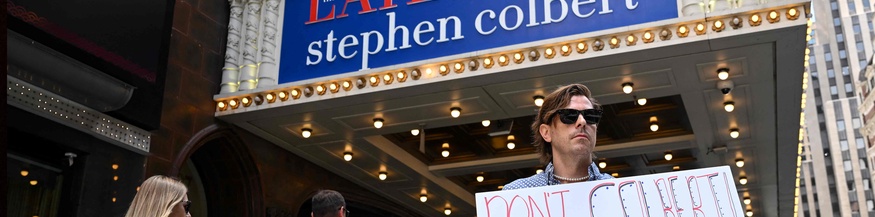Herkunft wichtiger als Wissen?
Der Mythos Elite
Manche tun sich einfach leichter: beim Sprachenlernen, beim Rechnen, beim Malen. Aber sind es immer die Begabten, die dann auch zur Elite gehören? Nein, meint die neuere Elitenforschung. Maßgeblich für den beruflichen Aufstieg ist die Herkunft.
8. April 2017, 21:58
WER es WIE schafft, das hat der deutsche Soziologe Michael Hartmann vor wenigen Jahren genauer untersucht. Er untersuchte die Karrieren von über 6000 Ingenieuren, Juristen und Naturwissenschaftern, die zwischen 1955 und 1995 promovierten.
Dabei zeigte sich: nicht die Bildung und der akademische Rang waren für den Aufstieg in Spitzenpositionen maßgeblich, sondern die Herkunft. Ein Beispiel: Der Sohn eines leitenden Angestellten hat eine 10mal größere Chance in die Führungsetage eines Großunternehmens zu kommen als der Sohn eines Arbeiters - mit gleicher Bildung, gleicher Universität, gleichen Auslandssemestern etc. Der Sohn eines Geschäftsführers hat sogar eine 17mal höhere Chance.
Die Gesellschaft prägen und beeinflussen
Für Michael Hartmann gehören jene zur Elite, die eine Gesellschaft maßgeblich prägen und beeinflussen können. Meist rechtfertigen Eliten ihre Sonderstellung durch die weit überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit - für Michael Hartmann nichts mehr als ein Mythos, denn Eliten können normalerweise nicht mehr absteigen, Leistungsträger schon.
Letzteren geht es wie Sportlern, die ihren Zenit überschritten haben, meint der Soziologe. Gescheiterte Wirtschafts-Bosse verschwinden hingegen mit Millionen-Abfertigung kurze Zeit in der Versenkung, um dann wieder groß zurückzukehren.
Ursprünglich ein Kampfbegriff
Ursprünglich wurde der Begriff Elite im 18. Jahrhundert vom aufstrebenden französischen Bürgertum als demokratischer Kampfbegriff gegen Adel und Klerus entwickelt, wie Hartmann in seinem Buch "Elitensoziologie" schreibt. Die individuelle Leistung sollte an Stelle der familiären Abstammung die gesellschaftliche Position bestimmen.
Eine Weile war der Begriff "Elite" verpönt - vor allem durch den Faschismus. Er rechtfertigte mit der behaupteten Überlegenheit einer Minderheit über eine Mehrheit das Führerprinzip.
Elite - eine zentrale Metapher
In den 90er-Jahren wurde der "Eliten"-Begriff wieder salonfähig, mittlerweile scheint er eine zentrale Metapher zu sein, um einzelne von der Masse abzuheben.
Viel wird von Führungseliten gesprochen, von Elitenförderung, von Elite-Universitäten. Für Hartmann hat die Eliten-Diskussion primär die Bedeutung, eine Art Sozial-Darwinismus und damit Ungleichheiten in der Gesellschaft zu rechtfertigen. Die Botschaft dahinter: Gewinner und Verlierer seien naturgegeben.
Nur teilweise Chancengleichheit
Bildungsexpansion - einer der zentralen Begriffe des letzten Vierteljahrhunderts. Sie sollte die Bildungseinrichtungen auch für die so genannten "einfachen Leute" öffnen.
Daten aus der letzten Volkszählung belegen, dass dieser Versuch, mehr Chancengleichheit zu schaffen, nur zum Teil erfolgreich war. Sie zeigen, dass die Ausbildung von Kindern nach wie vor sehr stark vom sozialen Hintergrund der Eltern bestimmt wird. So machen 90 Prozent der Akademikerkinder Matura. Wenn die Eltern nur einen Pflichtschulabschluss haben, besuchen ihre Kinder hingegen zu mehr als 80 Prozent die Hauptschule.
Benachteiligung einfacher sozialer Schichten
In Österreich entscheidet sich mit dem Halbjahreszeugnis der 4. Klasse Volksschule - und damit mit der Einschätzung der Volksschullehrer, ob ein Kind "reif" ist für das Gymnasium. Hartmanns Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder von begüterten Eltern bei gleicher Leistung dreimal häufiger eine "Gymnasial-Empfehlung" bekommen als Kinder "kleiner Leute".
Und so benachteiligt für den Wiener Bildungsforscher und OECD-Berater Karl Heinz Gruber die frühe Bildungs-Selektion vor allem die Kinder aus einfachen sozialen Schichten.
Gesamtschule für alle
Es gebe auch genügend Untersuchungen, die zeigen, dass die Leistungen eines Zehnjährigen noch lange nichts über seine Begabungen aussagen, so Gruber. Im Gegenteil würden sich erst nach der Pubertät "Begabungsmuster" herausbilden.
Karl Heinz Grubers Schlussfolgerung: eine Gesamtschule für alle Pflichtschüler so wie in den PISA-Siegerländern Kanada oder Finnland. Sie gibt Kindern, die daheim kein erstklassiges Lernumfeld vorfinden, die Chance, aufzuholen und ihre Begabungen zu entfalten.
Mehr zum Thema Bildung und Lernen in oe1.ORF.at
Mit Kindern wachsen
Die Schlüsselrolle des Lehrens
Gehrer lässt gemeinsame Schule prüfen
Grüne gegen verpflichtende Sprachkurse
Gehrer will Förderunterricht verbessern
Gratis-Schule: ÖVP gegen Zweidrittelmehrheit
Reform der Lehrerausbildung nicht ohne die Kirche
Ganztagsschule: SPÖ für Wahlmöglichkeit
Bildungsreform: Zwei-Drittel-Mehrheit dringend abschaffen
FPÖ: Lehrer sollen sich in Schulen vorbereiten
PISA und die Folgen
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Buch-Tipp
Michael Hartmann, "Der Mythos von den Leistungseliten", Campus Verlag, ISBN 3593371510
Michael Hartmann, "Elitensoziologie", Campus Verlag, ISBN 3593374390