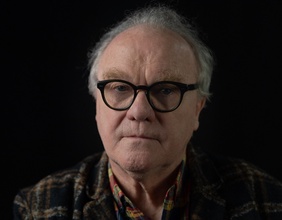Die Entfaltung des Selbstdenkens
Der pädagogische Eros
Durch Anpassung an die zivilisatorischen Zwänge verliere der Mensch seine Identität, meinte der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau. Die Gegenstrategien reichen von Anleitungen zur strikten Disziplinierung bis zur antiautoritären Erziehung.
8. April 2017, 21:58
Die optimale Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit innerhalb eines vorgegebenen sozialen Umfeldes zu ermöglichen - so lautet die Vorstellung verschiedener Philosophen zum Thema Erziehung. Bereits Immanuel Kant sprach in seinen Ausführungen zur Pädagogik davon, - "die Entwicklung der natürlichen Anlagen des Menschen" zu fördern, um aus ihm eine selbstbewusste, moralische Person zu machen.
Antiautoritäre Erziehung oder Disziplinierung?
Die Frage, wie dieses Ziel erreicht werden soll, beschäftigt die Philosophen seit der Antike. Die Lösungsvorschläge reichen von Anleitungen zur strikten Disziplinierung bis zur Aufforderung, dem Jugendlichen die Chance zu bieten, sich ohne autoritäre Anweisungen selbst zu entfalten.
Das Erziehungsmodell des Dressurakts, das den jungen Menschen in eine reine Denkmaschine verwandelt, stieß bei den meisten Philosophen auf vehemente Ablehnung. So etwa sprach Karl Jaspers in diesem Zusammenhang von dem scholastischen Modell der Erziehung. Diesem Konzept stellte er die sokratische Erziehung gegenüber.
Erziehung als Hebammenkunst
Die sokratische Erziehung erfolgte im Gespräch auf dem öffentlichen Marktplatz von Athen. Sokrates wollte verunsichern; er stellte ironische Fragen, die seine Gesprächspartner dazu brachten, ihr vermeintliches Wissen als Scheinwissen zu entlarven.
Dadurch kam es zu einer grundlegenden Verunsicherung, zum Eingeständnis "Ich weiß, dass ich nichts weiß." Dieser Nullpunkt des Wissens war die Voraussetzung der sokratischen Mäeutik - der Hebammenkunst - die durch gezielte Fragen zu einem folgerichtigen Denken verhelfen sollte.
Selbstdenken
Auf das kreative Denken setzte der französische Philosoph Michel de Montaigne, der von 1533 bis 1592 lebte. In seinem Hauptwerk "Essais" wandte er sich gegen das Auswendiglernen des Lehrstoffs, gegen das gedankenlose "papageienhafte" Nachplappern, das zur Unmündigkeit und Abhängigkeit von Autoritäten führt. Den Schüler ermunterte Montaigne, das Selbstdenken zu entfalten.
Klassiker der Pädagogik
Das Wohlbefinden des Kindes steht auch im Mittelpunkt der Überlegungen des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Sein Erziehungsroman "Emile" erschien 1762. Rousseau ging dabei von der These aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei; nur die Gesellschaft korrumpiere das Individuum. Durch Anpassung an die zivilisatorischen Zwänge verliere der Mensch seine Identität; er könne nicht mehr er selbst sein, sondern müsse sich verstellen und eine Rolle spielen, um den Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden.
Rousseaus Roman "Leben ist der Beruf, den ich ihn lehren will" entwirft die Vision einer geglückten Erziehung, die 25 Jahre andauert. Rousseau betrachtet das Kind als gleichberechtigten Partner, nicht als unbeschriebenes Blatt, das mit abstraktem Wissen überhäuft werden sollte. Voll Leidenschaft setzte sich Rousseau für das Recht auf die Selbstbestimmung des Kindes ein, selbst auf die Gefahr, dass es Fehler begeht oder gar auf Irrwege gerät.
Konkrete Anleitungen
Um den souveränen Zustand der Freiheit in der Gesellschaft erhalten zu können, bedarf es nach Rousseau eines langwierigen Erziehungsprozesses, den er in vier Abschnitte teilt:
Bis zum fünften Lebensjahr steht das körperliche Wachstum des Kindes im Zentrum der pädagogischen Bemühungen - das Kind soll sich gut entwickeln. Voraussetzung dafür ist eine gesunde Ernährung. Vom fünften bis zum zwölften Lebensjahr erfolgt die Auseinandersetzung des Kindes mit seiner natürlichen Umwelt; in dieser Phase spielt die Ausbildung der Sinnesorgane eine wichtige Rolle.
Zwischen 12 und 15 Jahren kommt es dann zur Schulung der geistigen Fähigkeiten; das Kind soll lernen, sein Denkvermögen eigenständig zu entfalten. Selbsttätiges Denken darf dabei nicht mit der Ansammlung von Wissen verwechselt werden, daher verzichtet der ideale Erzieher weitgehend auf Bücher. Zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr erfolgt die Sozialisierung des Jugendlichen, er muss sich allmählich in die bestehende Gesellschaftsordnung einfügen, ohne dabei seine Persönlichkeit aufzugeben.
Download-Tipp
Ö1 Clubmitglieder können die Sendung am Donnerstag, dem 28. Oktober, nach Ende der Live-Ausstrahlung des dritten Teiles im Download-Bereich runterladen.