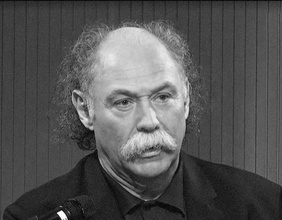Ein Symposion am Institut für Kirchengeschichte
Kirchliche Alltagsgeschichten
Die Bedeutung der Heiligen im Alltag, die Entwicklung des Wallfahrtswesens, das ganz normale alltägliche Leben von Klerikern: diese und ähnliche Themenbereiche stehen im Zentrum der kirchlichen Alltagsgeschichte.
8. April 2017, 21:58
Der Wiener Historiker Herwig Wolfram über Heilige
Am Wiener Institut für Kirchengeschichte der katholisch-theologischen Fakultät haben sich Profan- und Kirchenhistoriker aus mehreren Ländern zu einem internationalen Symposion zur kirchlichen Alltagsgeschichte getroffen. Der historische Bogen spannte sich von der Spätantike bis in die jüngste Vergangenheit, der inhaltliche Bogen von der Geschichte der Sünde über das Engagement der Caritas für Flüchtlinge bis hin zur Frage, wie sich Kirche in einer postmodernen Gesellschaft präsentiert.
Religiöser Alltag - geschichtlich aufbereitet
Klassische Kirchengeschichte, das ist die Geschichte der großen Entscheidungen der Päpste, Kardinäle und anderer hoher kirchlicher Würdenträger, auch jene der verschiedenen kirchlichen Institutionen. Es gibt aber auch eine andere Geschichte, nämlich die Geschichte der kleinen Leute, der Gläubigen, die so gut wie nie in der großen Geschichtsschreibung vorgekommen sind. Wie der Glauben das alltägliche Leben der Menschen geprägt hat, das ist ein relativ junges Forschungsgebiet im Rahmen der Kirchengeschichte.
Die Rolle der Heiligen
Seit rund 1800 Jahren prägt das Christentum die europäische Kultur. Archive und Bibliotheken bieten einen unendlichen Fundus an biografischen Zeugnissen über alltägliche Sorgen und Probleme der Menschen. In der Volksreligiosität spielten Heilige schon immer eine wichtige Rolle. Sozusagen als Vermittler zwischen Gott und den Menschen konnte man ihnen persönliche Probleme anvertrauen. Und auch gewisse Dinge einfordern. Der Wiener Historiker Herwig Wolfram dazu:
"Mit dem lieben Gott zu kommunizieren, bringt nicht ein jeder zusammen, aber mit den Heiligen kann man reden, wie von Du zu Du."
Die Wallfahrten
Wallfahrten gehören ab dem Mittelalter zu den markantesten Erscheinungen der Volksfrömmigkeit. Zu Beginn führten Wallfahrten vor allem ins Heilige Land, später nach Rom, Santiago de Compostela oder Aachen. Ab dem 14. Jahrhundert wurde die kleinräumige Wallfahrt immer beliebter. Peter Steiner, Direktor des Diözesanmuseums in Freising, hat sich mit der Geschichte der Wallfahrten zum Passauer Marienbild "Mariahilf" beschäftigt:
"Die Passauer Mariahilf ist - typisch für Wallfahrten - in Notzeiten entstanden. Die Wallfahrt zum Mariahilf-Bild hat im Jahr 1624 begonnen. Und bereits wenige Jahre später tauchen Meldungen über den kommerziellen Erfolg der Mariahilf-Kopien auf. Innerhalb weniger Jahre sind Dutzende Mariahilf-Kirchen erbaut worden. Und für einige Berufsgruppen ist die Mariahilf-Madonna besonders wichtig geworden. In Wien ist ein ganzer Stadtteil nach der Mariahilf-Madonna benannt worden."
Die Bruderschaften
Ein wichtiges Element der Heilsversicherung des Einzelnen waren ab dem späten Mittelalter die sogenannten Bruderschaften. Diese Vereinigungen boten Schutz und ein religiöses Erlebnis. Bruderschaften waren in Österreich im 17. und 18. Jahrhundert ein Massenphänomen. Rupert Klieber, Dozent am Institut für Kirchengeschichte der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien, betont den religiösen und karitativen Charakter der Bruderschaften:
"Bruderschaften hatten vielfältige Aufgaben. Die wichtigste war die Zusage, dass man feierlich bestattet wird. Und nicht zu unterschätzen waren die Leistungen an die Mitglieder für die Zeit nach dem Tod. Die Mitgliedschaft in einer Bruderschaft konnte die Strafzeit im Fegefeuer deutlich verringern. Bruderschaften hatten neben dem gebotenen liturgischen Programm auch die Aufgabe, für Geselligkeit zu sorgen."
Die Kindeserdrückung
Das Spannungsfeld von weltlichen Gerichten und kirchlichen Sanktionen ist ein breites Feld in der kirchlichen Alltagsgeschichte. Christine Tropper vom Kärntner Landesarchiv hat in den Gurker Konsistorialprotokollen unzählige Aufzeichnungen über die sogenannte Kindeserdrückung gefunden:
"Trotz kirchlichen Verbotes war es oft Usus, dass Kinder im Bett der Eltern oder der Mutter schliefen. Auf Grund der Arbeitsbelastung sind Mütter oft und oft beim Stillen eingeschlafen und haben dabei ihre Kinder buchstäblich erdrückt. Die Täterinnen wurden damals dafür aber nicht strafrechtlich verfolgt, sondern man hat ihnen in der Kirche Buße auferlegt."
Die Kindeserdrückung war über Jahrhunderte eine der häufigsten Todesursachen für Kleinkinder. Von Historikern wurde sie lange Zeit als eine Form der nachträglichen Geburtenregelung betrachtet.
Die Not von Flüchtlingen
Die Not der stillenden Mütter ist nur mehr in vergilbten Archivalien nachzulesen. Die Not von Flüchtlingen ist heute nach wie vor sehr aktuell. Und die Caritas der katholischen Kirche hat sich Zeit ihres Bestehens um Flüchtlinge gekümmert. Kleinräumige Studien lassen die persönlichen Schicksale aus der anonymen Masse deutlich hervortreten. Der Historiker Manfred Eder untersuchte die Arbeit der Ortscaritasstelle Waldsassen in Bayern in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg:
"Wenn damals Kinder verlorengegangen und später aufgefunden worden sind, half keine Suchstelle; die Kinder sind in Heimen gelandet."
Durch Alltag entstehen Konturen
Im alltagsgeschichtlichen Mikrokosmos werden aus den Opfern der großen Geschichte individuelle Schicksale, die anonyme Not bekommt Gesichter. Die große Geschichte bekommt Konturen.
In der Aufarbeitung kirchlicher Alltagsgeschichten stecken noch viele unberührte Aspekte, die erforscht werden können. Und die vielfältigen Zugänge und die Fülle an Fallbeispielen zeigen, dass diese Forschungsrichtung noch viel Überraschendes zu bieten haben wird.
Mehr zu Religionssendungen im ORF in religion.orf.at
Link
Wiener Institut für Kirchengeschichte