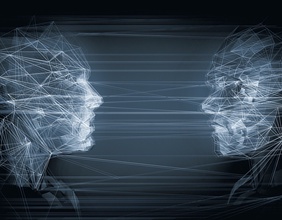Wie kommt die Musik in den Komponistenbauch?
Der Bauch des Komponisten
Gerald Resch (28) gehört zur jungen, aufstrebenden österreichischen Komponistengeneration. Die Werke des auch publizistisch umtriebigen Tonsetzers werden nun von Doblinger verlegt. Für oe1.ORF.at beschreibt er, wie die Musik in den Komponistenbauch kommt.
8. April 2017, 21:58
in die tiefe seines bauches
nach wörteralgen taucht der dichter
am weißen strand des papieres
spreitet er sie zum trocknen aus:
es wird gebeten das seegras nicht
vor seiner zeit zu wenden
danke
(H.C. Artmann)
Das Verschweigen der Außenwelt
In dem vorangestellten Gedicht von H.C. Artmann wird der schöpferische Prozess als sehr einsame Tätigkeit beschrieben: kein Wort davon, wie sich der Bauch des Dichters mit Wörteralgen befüllt, kein Wort davon, wie der Dichter mit seinem prallen Bauch sich in der Öffentlichkeit bewegt, ob es schmerzhaft ist, wenn er mit seinem Wanst an Kanten anstößt, oder ob im Gegenteil so mancher Stoß abgefedert wird durch den Dichterbauch, der als weicher und elastischer Schutzschild vor ihm herschwappt: sicher auch ein gutes Gefühl, seinen Dichterbauch vor sich herzutragen und schwanger zu gehen mit den eigenen Wörteralgen...
Man ist, was man isst
Das Gedicht verliert kein Wort darüber, welche Rolle die Außenwelt dabei spielt, damit sich der Bauch des Dichters - oder auch der Bauch des Malers, Regisseurs, Komponisten - überhaupt mit Algen befüllen kann, die es wert sind, zum Trocknen ausgespreitet zu werden.
Und doch, obwohl die Öffentlichkeit in Artmanns Gedicht verschwiegen wird, ist offensichtlich, dass Nahrungsaufnahme nur dann stattfinden kann, wenn der Esser zulässt, dass etwas von Außen in ihn eindringt. Man ist, was man isst: im übertragenen Sinn trifft dieser Satz für jede kreative Tätigkeit besonders zu. Er stellt auch klar, dass es kein Sein gibt ohne Essen und Verdauen, ohne Aufnahme der schmackhaften Außenwelt zum egoistischen Zweck, sich davon zu ernähren.
Parallele Öffentlichkeiten
Schade, dass dieser symbiotische Zusammenhang zwischen Außenwelt und Künstler, zwischen Öffentlichkeit und Komponieren, so wenig bewusst und schwer zu durchschauen ist. Einer der möglichen Gründe dafür ist sicherlich der, dass es nicht nur eine einzige Öffentlichkeit gibt. Die Öffentlichkeit, die etwa gerne in Konzerte geht, ist fast immer eine ganz andere als die, mit der man den eigenen Lebensbereich teilt und die - auf meist verschlungenen Pfaden - die kompositorische Arbeit stark beeinflusst.
Ich glaube, dass es unserer Zeit adäquat ist, sich parallel in unterschiedlichen Öffentlichkeiten zu bewegen und an ihnen teilzunehmen. Vielleicht könnte es Aufgabe einer zeitgemäßen Musik sein, von dem Leben in parallelen Bereichen Zeugenschaft abzulegen.
Komponieren unter Beobachtung
Da Komponieren eine prinzipiell einsame Tätigkeit ist (der man meistens in Abgeschiedenheit ohne störende Nebengeräusche nachgehen will), scheint es natürlich zu sein, dass selbst eine interessierte Öffentlichkeit sehr wenig Möglichkeiten hat, daran teilzuhaben, wie ein Musikstück entsteht.
Üblicherweise findet der größte Teil der Komponier-Arbeit im privaten Raum statt, und wenn eine neue Komposition erstmals auf die Öffentlichkeit trifft, ist sie in der Regel bereits vollständig. Es könnte sehr interessant sein, probeweise unter Anwesenheit eines Publikums zu komponieren und ihm zu erklären versuchen, welche Überlegungen gegeneinander abgewogen werden, wenn man sich entscheidet, den nächsten Takt auf diese Weise zu schreiben.
Über das Entscheiden
Vielleicht wäre es zwar manchmal desillusionierend, wie wenig konkrete Auskunft ein Komponist darüber geben kann, was sich während seiner Arbeit tatsächlich abspielt und durch welche Kräfte die Fäden gezogen werden, die eine Musik hervorbringen.
Den Großteil der Entscheidungen, die im Verlauf einer Komposition zu treffen sind, kann meiner Erfahrung nach auch er selbst nicht erschöpfend erklären, da die unbewussten persönlichen Vorlieben und Abneigungen, durch die seine Arbeit gesteuert wird, von ihm nicht bis ins Letzte durchschaut werden können. Allerdings würde auch die Beobachtung, dass vieles - sogar für den Komponisten selbst - unerklärbar bleibt, das Verständnis für die rationalen und irrationalen Aspekte des Musikschreibens vertiefen.
Vom Ausfischen des Komponistenbauchs
So ähnlich wie im Gedicht von H.C. Artmann empfinde ich das Komponieren. In der Tiefe des Komponistenbauches, in den niemals ein Strahl Tageslicht fallen wird, sammelt sich ein Reservoire, das sich aus persönlichen Vorlieben und Abneigungen, Gewohnheiten, Verboten, Eitelkeiten und vor allem zahllosen fremden Fundstücken zusammensetzt: ein heilloses Durcheinander wie bei einem Walfisch, der mit offenen Barten durchs Meer treibt und dabei alles aus dem Wasser seiht, was sich in ihnen verfängt. Eine interessante Art der Nahrungsaufnahme: Alles Kleine wandert in den Walfischbauch, alles Große verheddert sich in den Barten und wird ausgespuckt.
Ich glaube, dass ein möglichst umfangreiches Ausfischen des eigenen Bauches dabei behilflich sein wird, zu erkennen, wodurch die kompositorische Arbeit geprägt wird (nicht alle gefundenen Algen müssen getrocknet werden). Immer wieder wird es nötig sein, dieses Reservoire neu zu befüllen, zu putzen, zu erweitern und ihm neue Freiräume zu schaffen. Alles, was dazu behilflich sein kann - ob musikalischer oder nicht-musikalischer Natur - sollte dazu verwendet werden und prinzipiell ins eigene Reservoire Eingang finden dürfen.
Techniken, Fertigkeiten, Lösungen
Die Technik, nach Wörteralgen zu tauchen, findet ihre Entsprechung in den kompositionshandwerklichen Fertigkeiten. Je feiner sie mit wachsender Erfahrung werden, desto vielfältiger werden die Möglichkeiten, vorerst nur vage imaginierte Klangvorstellungen konkret umzusetzen. Mit wachsender Erfahrung sollte es verhältnismäßig immer leichter fallen, Lösungen zu finden, mittels derer die bisherige eigene Norm laufend erweitert wird.
Andererseits sollte nicht unterschätzt werden, dass ein immer souveräner beherrschtes Kompositionshandwerk auch eine gewisse Versuchung darstellen mag, nahe liegende Lösungen zu wählen, da sie bereits erprobt sind und sich bewährt haben. Die Grenzen sind fließend, ob ein Komponist einfallslos sich selbst kopiert oder das einmal Gefundene immer weiter verfeinert. Er selbst freilich wird stets dazu tendieren, Zweites anzunehmen...
Link
Doblinger