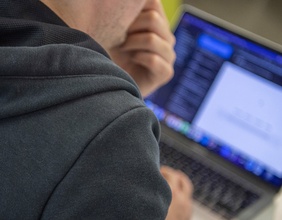Scheinbar ewig jung
Mit dem Enkel zum Rockfestival
Popmusik war in der Vergangenheit für Jugendkulturen und deren Abgrenzungen zu den "Alten" von Bedeutung. Die Musik der Eltern zu hören, galt am Beginn der Popmusik als "uncool". Heute gibt es diese scheinbar eindeutigen Abgrenzungen nicht mehr.
8. April 2017, 21:58
"Hope To Die Before I Get Old" - Ich will lieber sterben als alt werden. Der, der diese Songzeile schrieb, ist heute 62 Jahre alt. Pete Townshend, der Autor des Songs "My Generation" und Sänger der britischen Rockband "The Who" ist weder verstorben, noch hat er sich aus der Musik zurückgezogen.
Pete Townshend hat 2006 ein Album veröffentlicht und tourte im selben Jahr mit "The Who" durch ausverkaufte Konzerthallen auf der ganzen Welt. Townshend, ein Mann mit grauem Bart und nicht mehr ganz so dichter Haarpracht, ist heute erfolgreicher als am Beginn seiner Popkarriere 1964.
Am Puls der Zeit
Der Erfolg von Pete Townshend ist nicht exemplarisch für alternde Popmusiker, doch lebt er vor, wie man im fortgeschrittenen Alter eben nicht auf dem popmusikalischen Abstellgleis landet. "One hit wonders" - junge Popsternchen, die nach einem Erfolg in der Hitparade in die Bedeutungslosigkeit abfallen - gibt es eine Menge.
In keinem anderen Musikgenre können sich Bedeutung und Ansehen eines Musikers derart schnell verändern - und das hat mit der Anbindung der Popmusik an Jugendlichkeit zu tun: Pop muss laut Eigendefinition jung und immer am Puls der Zeit sein, und wer dem nicht entspricht, fällt schnell auf die hintersten Plätze der Hitparaden, oder muss auf den Couches diverser Retro-Musik-Sendungen im Privatfernsehen Platz nehmen.
Zu alt für Pop
Rückblickend war die Kategorie Jugend konstituierend für die Popmusik und ihre Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, die Popstars. Die ersten, die das zu spüren bekamen, waren Frank Sinatra oder auch Dean Martin, die am Beginn des Pop als zu alt angesehen wurden und deshalb von jüngeren Musikern wie Ray Charles oder Elvis Presley abgelöst wurden.
Sheila Whiteley, Professorin für Popularmusik der University of Salford, sieht in der ständigen Nachfrage nach jungen Musikern und Musikerinnen eine Konstante der Popmusik: "Jemanden mit 16 Jahren ganz groß zu machen und dann wieder in die Bedeutungslosigkeit fallen zu lassen, das gibt es ja nicht erst seit diesen Castingshows im Fernsehen, sondern diese Geschichte ist so alt wie die Popmusik selbst." Anders als beim Jazz oder in der klassischen Musik, wo musikalische Reife und Erfahrung geschätzt werden, galt in der Popmusik Jugend als Vorteil.
Öffentliches Ausdrucksmittel für Jugendlichkeit
Nicht nur die Musiker und Musikerinnen mussten jung sein, auch die Rezipientinnen und Rezipienten, Fans und Plattenkäufer und -käuferinnen waren im selben biologischen Alter wie ihre Stars. Popmusik war öffentliches Ausdrucksmittel für Jugendlichkeit und dadurch Motor diverser Jugendkulturen. Der Rock 'n' Roll der 1950er und 1960er war nicht nur Musik, sondern ein "Schrei", ein hör- und tanzbares Zeichen der jugendlichen Rebellion, wie es der deutsche Autor Thomas Steinfeld beschreibt.
Über die Popmusik und durch deren Abgrenzung zur Musik der Eltern konnte sich eine Generation in den USA und in Westeuropa eine eigene, selbstbestimmte Identität aufbauen und wurde erst dadurch zum historischen Subjekt. So offen die Popmusik bezüglich sozialer und kultureller Herkunft ihrer Rezipientinnen und Rezipienten war, eine klare Grenze gab es von Beginn an: Pop war keine Musik für Menschen über 30!
Neue Jugendkulturen
Die Fokussierung auf die Jugend hielt die folgenden Jahrzehnte an. Neue Musik- und Stilrichtungen im Pop gingen Hand in Hand mit dem Aufkommen neuer Jugendkulturen: Disco und Punk in den 1970er Jahren, New Wave und Hip Hop in den 1980er Jahren, oder Techno und Grunge im vergangenen Jahrzehnt.
Die Jugendkulturen mit ihren Moden, Verhaltens- und Lebenseinstellungen waren zumindest oberflächlich stets verbunden mit einer neuen Musikrichtung, die ältere Generationen ausschloss oder von ihr unverstanden blieb. Es gehöre zur Eigenart der Popmusik, "dass die meisten ihrer begeisterten Hörer das innere Ohr zuklappen, wenn sie die späte Jugend hinter sich gelassen haben und fortan nur noch das zu ihnen dringt, was sie schon von früher kennen", schreibt Thomas Steinfeld.
Paradigmenwechsel
Nach einem halben Jahrhundert Popmusik kam es in den letzten Jahren zu einem Paradigmenwechsel: Die Jugend hat die Diskurshegemonie in der Popmusik verloren. Über 50 Jahre Popmusik haben zumindest zwei Generationen mit Pop kulturalisiert, und sie denken heute gar nicht daran, sich in die musikalische "Pension" zurückzuziehen: Wer mit den Beatles, den Rolling Stones oder The Who die 1960er Jahre oder später in den 1970er Jahren mit Led Zeppelin die Teenagerjahre musikalisch verbracht hat, ist heute nicht mehr jung, doch immer noch (pop-)musikbegeistert.
Die Nachfrage nach Konzerten von den "Großvätern des Rocks" sind dafür Belege, wie jenes Konzert der Band Led Zeppelin im Dezember 2007 in London, das innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Nach Auskunft der Veranstalter hatten sich für die 20.000 Eintrittskarten über 20 Millionen Menschen im Internet angemeldet und das trotz Ticketpreisen von 175 Euro. Die zahlreichen Fans von damals sind mit ihren Popstars gealtert und können und wollen sich heute die teuren Karten für ihre Konzerte leisten.
Jugendlichkeit hat heute längst nichts mehr mit biologischem Alter zu tun, und folglich ist auch die Popmusik von der Einschränkung auf Jugend entledigt.
Altes neu arrangiert
Mittels Stil-Revivals versuchen junge Bands den Erfolg ihrer Vorväter nachzuahmen: Alte Popmusik wird neu arrangiert und das mit Erfolg, wie britische "Garage Rock"- oder "New New-Wave"-Bands wie Arctic Monkeys oder Franz Ferdinand beweisen. Diese Musik grenzt keine Altersgruppe mehr aus. Deshalb wundert es nicht, dass heute Eltern und ihre Kinder gemeinsam auf Popkonzerte gehen. Wahrscheinlich sind es weniger die Musikerinnen und Musiker als vielmehr der ökonomische Druck auf die Plattenlabels, der zu generationsübergreifender Popmusik führte. Die Zielgruppe von Popmusik und damit die Verkaufszahlen der Musik haben sich mit dieser Entwicklung klarerweise vergrößert.
Die neue und rebellische Popmusik hat heute eine Plattform im Internet gefunden. Auf Websites wie myspace.com können sich Musikerinnen und Musiker abseits vom "gealterten" Mainstream der Popmusik präsentieren. Dort kann Musik ohne Beschränkungen durch Produktions- bzw. Plattenfirmen und weitgehend abgekoppelt vom marktwirtschaftlichen Zielgruppendenken bestehen.
Hör-Tipp
Radiokolleg, Montag, 21. Jänner bis Freitag, 24. Jänner 2008, 9:45 Uhr
Mehr dazu in oe1.ORF.at