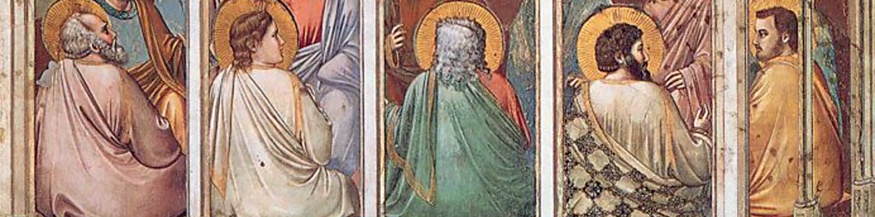Missverständnisse vorprogrammiert
Das Phänomen Richard Wagner
Er gab allen alles. Man musste es sich nur aussuchen. Mit Wagner kann man nicht nur Musik machen, man kann auch Politik und vor allem Revolution machen. Anmerkungen zum 125. Todestag des nach wie vor größten Musikphänomens.
8. April 2017, 21:58
Er gilt als das bedeutendste, das überschätzteste, das verehrteste, das geliebteste, das gehassteste, das verspottetste, jedenfalls aber als das meistdiskutierte Operngenie des 19. Jahrhunderts, ja wahrscheinlich aller Zeiten: Richard Wilhelm Wagner, geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig, gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig an einem Herzinfarkt.
Zwischen diesen beiden Daten entstand eine neue Welt des Theaters, eine Revolution, die gegen andere ebenso kämpfte wie gegen sich selbst, in der der Weg zum Ziel wurde. Auch Wagner selbst kämpfte im Grunde genommen gegen sich, schwang sich zu Höhen empor, die kein anderer erreichen konnte, um im nächsten Moment wieder abzustürzen. Er verlangte Unmögliches von sich und provozierte sein Gegenüber zu jenen Wundern, die sein eigener Geist erdacht hatte.
Politik und Revolution
Viele wollten sich an Richard Wagner messen und sind gescheitert: Künstler, Politiker, Philosophen. Frei nach dem Bibelwort "gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist" hat Wagner allen alles gegeben. Man musste es sich nur aussuchen. Mit Wagner kann man nicht nur Musik machen, man kann auch Politik und vor allem Revolution machen. Wagner ist universell "benützbar" und in seiner Gegensätzlichkeit daher auch schwer begreifbar, Missverständnisse sind vorprogrammiert.
Ich habe heute nachgemessen: Meine eigene Wagner-Bibliothek misst cirka sechs Meter. Was tatsächlich über ihn geschrieben wurde, dürfte jedoch mindestens das zehnfache sein, doch fühle ich mich auch nicht als Wagnerianer. Und wenn schon, dann ebenso als Mozartianer und Verdianer.
Was ist eine gute Wagner-Interpretation?
Trotzdem gibt es kaum eine Musik, die mich ähnlich stark berühren kann wie die Wagners; zeitweise Langeweile mit eingeschlossen und stark anhängig von den Interpreten. Dabei ist es nicht unbedingt die oft angesprochene Einheit zwischen dem Textdichter Wagner und seiner eigenen Musik, die einen in ihren Bann zieht, sondern eher der Gleichklang einer Stimme mit der Intensität der musikalischen Sprache.
Eine Interpretation, die etwa durch ihre gesangstechnischen Mängel ablenkt, gleitet leicht ins Banale ab, lässt die bedrückende oder erlösende Kraft eines sich aufbauenden Höhepunktes oft geradezu lächerlich wirken.
Die heutzutage oft geübte Praxis auch erstrangiger Dirigenten, absolut unzulängliche Sängerinnen oder Sänger einfach als gottgegeben hinzunehmen und sie im Rausch der Wagner-Musik ebenso zu vergessen wie werkentstellende Inszenierungen und Bühnenbilder, stellt daher das wohl größte Verbrechen gegen den Gesamt-Künstler Wagner dar:
"Unter dem Publikum kann ich nie die Einzelnen verstehen, die vom abstrakten Kunstverständnisse aus sich mit Erscheinungen befreunden, die auf der Bühne nicht verwirklicht werden. Unter dem Publikum verstehe ich nur die Gesamtheit der Zuschauer, denen ohne spezifisch gebildeten Kunstverstand das vorgeführte Drama zum vollständigen, gänzlich mühelosen Gefühlsverständnis kommen soll (...) als vorgeführte allverständliche Handlung (...) das Publikum, das demnach ohne alle Kunstverstandesanstrengung genießen soll (...).
(aus Richard Wagner, "Oper und Drama", 1851)
Mehr zu Richard Wagner in oe1.ORF.at
Herrin des Hügels
Richard Wagners Erfolgsoper
Start zum neuen Wiener "Ring"
Bayreuther "Parsifal" bleibt umstritten
Diese Wagners!
Zukunft der Bayreuther Festspiele weiter offen
Richard Wagner und die Folgen|
Wagnerianer und Antiwagnerianer
Wagner total
Hör-Tipp
Apropos Oper, Dienstag, 12. Februar 2008, 15:06 Uhr