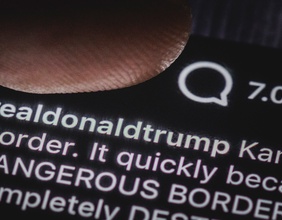Das Buch der Woche von Jenny Erpenbeck
Heimsuchung
Jenny Erpenbeck die Geschichte eines Hauses - aber tatsächlich geht es in ihrem Roman "Heimsuchung" um weit mehr. Am Ufer eines Sees liegt das Haus, und anhand der Schicksale seiner Bewohner arbeitet sich die Autorin durch die deutsche Geschichte.
8. April 2017, 21:58
Jenny Erpenbeck über das Sommerhaus ihrer Kindheit
Jenny Erpenbeck erzählt die Geschichte eines Hauses - aber tatsächlich geht es in ihrem Roman "Heimsuchung" um weit mehr. Schon im Prolog wird klar, dass Erpenbeck in größeren Zusammenhängen denkt.
Sie beginnt in der Urzeit, als sich gewaltige Eismassen langsam vorschieben, Felsbrocken geschliffen werden und schließlich nach Jahrtausenden das so genannte Märkische Meer entsteht.
Durch die deutsche Geschichte
Am Ufer dieses Sees liegt das Haus, und anhand der Schicksale seiner Bewohner arbeitet sich die Autorin durch die deutsche Geschichte. Sie erzählt vom Bauern, dessen Tochter Klara Ende des 19. Jahrhunderts das Grundstück am See erbt, aber den Verstand verliert. Sie erzählt vom Architekten, der in den dreißiger Jahren das Haus erbauen lässt und das Grundstück der jüdischen Nachbarn dazukauft. Die Nachbarn enden in der Gaskammer, nur der Sohn kann entkommen; und der Architekt flieht in den Westen, als die Russen vorrücken. Jenny Erpenbeck hat sich bei all dem weitgehend an die Historie gehalten und der Versuchung widerstanden, die Geschehnisse auszuschmücken.
"Die meisten Geschichten halten sich grundsätzlich an das, was wirklich passiert ist, aber natürlich hat man ja, wenn man Belletristik schreibt, die Möglichkeit, Dinge ein bisschen konzentrierter zu erzählen als sie vielleicht in Wirklichkeit passiert sind, und auch Dinge zu erfinden, wo man nicht weiß, was eigentlich war, aber auch bei diesen Sachen habe ich mich immer versucht an das zu halten, was historisch am wahrscheinlichsten gewesen wäre", so die Autorin.
Gärtner hält Geschichten zusammen
Zwölf Geschichten sind es insgesamt, und sie alle werden von einer ganz besonderen Figur zusammengehalten: dem Gärtner. Dieser Gärtner taucht immer wieder zwischen den Kapiteln auf, er verrichtet die notwendigen Arbeiten, beschneidet Bäume und Sträucher und scheint seltsam unberührt von den Schicksalen der Hausbewohner.
"Der Gärtner ist in dem Buch eigentlich die einzige Figur, die kein Charakter ist in dem Sinne, der hat kein Innenleben, sondern der hat eigentlich nur seine Tätigkeiten die er macht, und in gewisser Weise ist der für mich so ein bisschen eine Verlängerung dieses Eiszeit-Prologs, also so personifizierte Natur sozusagen", erläutert Erpenbeck.
Metapher für die Natur
Irgendwie scheint dieser Gärtner außerhalb der Zeit zu stehen, als Metapher für die Natur, die sich nicht um die Menschen kümmert. Woher er kommt ist ebenso unklar wie sein Ende - irgendwann ist er einfach verschwunden und nimmt sein Geheimnis mit sich.
"Ich habe so das Gefühl, dass der so eine Art ewiges Leben hat", so Erpenbeck. "Natürlich wird er im Lauf des Buches auch sichtlich älter, aber ich fand es schön, am Ende schreibe ich auch irgendwie, man vermutet, dass er sich nur noch von Schnee ernähre und das fand ich irgendwie eine gute Existenzform."
Großmutter war kommunistische Schriftstellerin
Während also der Gärtner schweigend die Bäume und Pflanzen pflegt, setzt sich die Geschichte des Hauses in der Nachkriegszeit fort. Hier folgt der persönlichste Teil des Buches, denn nun erzählt Jenny Erpenbeck von ihrer Großmutter, der kommunistischen Schriftstellerin, die in der Nazizeit in die Sowjetunion emigrierte und sich nach ihrer Rückkehr in der DDR wieder fand. Gerade dieser Abschnitt hat Erpenbeck einige Probleme bereitet.
"Man weiß genau, die einen denken sowieso, dass die Kommunisten Verbrecher sind und sagen, ja die hat eine kommunistische Großmutter, die verteidigt sie jetzt, ist ja ganz klar, so eine böse stalinistische Familie oder so was; wenn man sich davon vollkommen trennen würde und sich auf die andere Seite stellt und praktisch so jemanden als kurzsichtig beurteilt, dann würden wieder die anderen kommen und würden sagen, so eine Schweinerei, die verrät ihr familiäres Erbe und der Kapitalismus ist wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss und was für ein Jammer dass die Großmutter so eine Enkelin haben muss. Und zwischen diesen ganzen Klippen und Untiefen muss man dann eigentlich so den Weg finden, die Wahrheit zu beschreiben, die man selbst sieht oder die man vermutet", betont Erpenbeck.
Klangvolle Sprache
Jenny Erpenbeck manövriert sich geschickt durch all diese Klippen und Untiefen bis hin zu ihrer eigenen Geschichte, jener der unberechtigten Eigenbesitzerin. All dies erzählt sie in einer klangvollen Sprache, die immer irgendwo noch ein letztes Geheimnis zu verbergen scheint - und die nicht zuletzt das Vergehen der Zeit eindrucksvoll in Worte kleidet. Es sind poetische und leise, und gerade deshalb umso berührendere Worte.
Jenny Erpenbeck selbst hat sich freilich noch nicht ganz von der Geschichte des Hauses befreit - aber immerhin einen ersten, großen Schritt in diese Richtung getan: "Das Haus steht immer noch da und verfällt, also es ist verkauft worden aber ich habe so das Gefühl, dass derjenige, der es gekauft hat, das verfallen lassen will, damit er es dann abreißen kann, also da bin ich noch nicht so ganz beruhigt, andererseits - man muss irgendwie lernen, dass die Dinge eben nicht ewig sind und dass die Dinge, die vom Menschen gemacht sind, irgendwann auch mal kaputtgehen oder ausgewechselt werden; mir persönlich fällt das sehr schwer, weil ich jemand bin, der immer alles aufhebt, aber man muss es lernen, weil man sonst auch irgendwann einfach erstickt in diesem ganzen Zeug, was einen umgibt."
Hör-Tipp
Ex libris, Sonntag, 6. April 2008, 18:15 Uhr
Buch-Tipp
Jenny Erpenbeck, "Heimsuchung", Eichborn Verlag