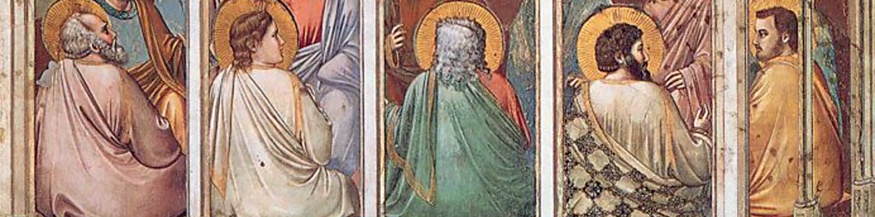Leben und Sterben in Darfur
Der Übersetzer
Worum es in der Auseinandersetzung im Sudan eigentlich geht, wird allzu leicht vergessen. Schließlich fehlt es uns meist an einer Innensicht des Konflikts. Diese liefert der Sudanese Daoud Hari, der als Übersetzer gearbeitet hat.
8. April 2017, 21:58
Als Daoud Hari vor einigen Jahren in seine Heimat Darfur zurückkehrte, fand er ein Bild des Grauens vor: niedergebrannte Häuser, zerstörte Dörfer, ermordete Bewohner; Menschen, auf der Flucht verhungert. Mit ein paar seiner alten Freunde begann Daoud Hari, Erkundungsritte im Grenzgebiet von Tschad und Sudan zu unternehmen, nach mordenden Reitermilizen Ausschau zu halten und sichere Routen in den Tschad ausfindig zu machen. Er half, Nahrung zu besorgen und Tote zu bestatten - Männer, Frauen und Kinder, deren Flucht vorzeitig zu Ende war.
Unter einem Baum unweit der Grenze zum Tschad fand er eine tote junge Frau mit zwei toten und einem noch lebenden Kind. Später erfuhr Daoud Hari die Geschichte dieser Frau, erfuhr, dass ihr Dorf überfallen, dass sie von Dschandschawid, berittenen arabischen Milizen, mehrfach vergewaltigt und schließlich mit ihren Kindern mitten in der Wüste, weitab von jedem Dorf, ausgesetzt wurde. Fünf Tage irrte sie durch die Wüste, die Kinder auf dem Arm, ohne Essen und Trinken. Als sie mit ihren Kräften am Ende war, begab sie sich unter einen Baum, nahm ihr Kopftuch ab, knotete es an einen hohen Ast und erhängte sich. So fanden sie Hari und seine Freunde. Sie nahmen den Leichnam vom Baum und begruben die Frau mit ihren drei Kindern. Denn auch für das dritte kam jede Hilfe zu spät: Es starb in den Armen der Männer.
"Dieser Moment begleitet mich jeden Tag", sagt Daoud Hari, der viel Schlimmes gesehen hat, aber vielleicht nichts Erschütternderes als dieses Bild. In seinem Buch "Der Übersetzer. Leben und Sterben in Darfur" schildert Daoud Hari Eindrücke und Erlebnisse aus einem geschundenen Land - und wird zum Übersetzer einer Tragödie für ein Publikum, dem diese Tragödie, fernab von den Kameras der westlichen Massenmedien, bisher fremd oder unverständlich geblieben ist. Hari will, dass mehr Geschichten aus Darfur hinaus in die Welt dringen. Das, schreibt er, sei seit dem Angriff auf sein eigenes Dorf "wirklich der einzige Grund geworden, für den ich weiterlebte."
Der Einzige mit Schulbildung
Daoud Hari kam 1974 in einem kleinen Dorf in Darfur zur Welt, als Angehöriger der Zaghawa, halbnomadischer Bauern. Anders als seine vier Brüder schickte sein Vater ihn, den jüngsten der Söhne, zur Schule. Daoud erinnert sich an eine glückliche Kindheit. Als 1989 im Sudan Ahmad al-Baschir an die Macht gelangte, kam es zu Übergriffen gegen die Zaghawa, von denen sich viele Widerstandsgruppen anschlossen.
Auch Daoud wollte Freiheitskämpfer werden und in den Tschad, ging aber dann doch weiter zur Schule und lernte Englisch. Sein Vater wollte aus ihm einen Kameltreiber machen, doch Daoud widersetzte sich diesem Wunsch. Er wollte etwas von der Welt sehen - und ging zunächst als Kellner nach Libyen, dann nach Ägypten und schließlich nach Israel. Dort wurde er, als illegal Einreisender, festgenommen und zurückgeschickt, saß in Kairo im Gefängnis und kam schließlich wieder frei. Als er endlich in den Sudan zurückkehren konnte, sah er Darfur in Flammen. Es war der Sommer 2003.
Dolmetscher für westliche Journalisten
Darfur - eine "bizarre Trauerlandschaft". Überall der Geruch von Verbranntem, der Gestank der Verwesung, überall Leichen und Flüchtlingskolonnen, Schwerverletzte, die Arme und Beine verloren und ohne medizinische Versorgung dahinvegetierten, andere mit von Chemikalien verätzten Körpern. Dschandschawid und sudanesische Armee-Einheiten zerstörten wahllos Dörfer. Menschen wurden in ihren Häusern bei lebendigem Leib verbrannt, Frauen wurden vergewaltigt und aufgeschlitzt, junge Männer mit der Machete niedergemetzelt, Kinder von Bajonetten aufgespießt.
Daoud Hari aber beschloss, nicht in den bewaffneten Widerstand zu gehen, sich nicht der Sudanesischen Befreiungsarmee anzuschließen, sondern in den Flüchtlingslagern zu helfen. "Der Umstand, dass ich Zaghawa, Arabisch und Englisch sprach, erwies sich als nützlich für die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen" - der NGOs -, "die zahlreich in den Tschad strömten."
Er verschaffte sich "tschadische Papiere", legte sich den Namen Suleyman zu und lotste westliche Journalisten, die sich vor Ort ein Bild von der Katastrophe machen wollten, vom Tschad aus in das Krisengebiet. Ein junger Amerikaner, der herausfinden sollte, ob es sich bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Darfur um Bürgerkrieg oder Völkermord handelte, fragte ihn, ob er ihn bei dieser Ermittlung als Übersetzer begleiten wolle. "Ich willigte ein", sagt Daoud Hari. "Ich hatte meine Bestimmung gefunden."
Jeder gegen jeden
Die Konflikte in Darfur sind alt. Schon früher stritten sich einheimische afrikanische Bauern und arabische Nomaden um Weideland. Bevölkerungsexplosion und Hungersnöte verschärften die Situation, doch erst die Politik al-Baschirs führte zum Krieg. Sie unterstützt die arabische Seite. Den arabischen Milizen, von der sudanesischen Regierung mit Waffen beliefert, stehen sudanesische Rebellen- und Befreiungsbewegungen gegenüber.
Zwar existiert offiziell seit April 2004 ein Friedensabkommen, de facto aber geht das Blutvergießen weiter. Und die Situation ist äußerst unübersichtlich. "Sudanesische Regierungstruppen, tschadische Rebellen, Darfur-Rebellen, Darfur-Rebellen unter dem Auftrag der Regierung, Dschandschawid - jeder kämpfte gegen jeden in den grenznahen Regionen, manchmal gar auf beiden Seiten der Grenze", schreibt Daoud Hari, der der sudanesischen Regierung unterstellt, aus ökonomischen Gründen an der Entvölkerung der ertragreichen Gebiete von Darfur interessiert zu sein.
Ob man Haris Lesart des Konflikts für eine objektive und hinreichend differenzierte hält oder nicht: Fest steht, dass die Situation dramatisch und die Hilfe von außen unzureichend ist. Die USA und China konnten sich wegen ihrer Handelsbeziehungen zum Ölland Sudan zu keiner harten Linie gegenüber al-Baschir durchringen. Fest steht auch, dass die Bilanz der letzten fünf Jahre erschütternd ist: rund 300.000 Tote und etwa zweieinhalb Millionen Menschen auf der Flucht.
Als Flüchtling in den USA
Der Job des Übersetzers ist kein ungefährlicher. Immer wieder setzte Daoud Hari sein Leben aufs Spiel, immer wieder geriet er, wenn er mit Reportern von "New York Times", von BBC oder "National Geographic" unterwegs war, zwischen die Fronten, wurde verhaftet, verhört, mit dem Tode bedroht.
Er beschreibt, wie er einen amerikanischen Reporter, den Pulitzer-Preisträger Paul Salopek, begleitete, der Flüchtlinge in den Lagern interviewen und Rebellen treffen wollte, und mit ihm in die Hände von Kindersoldaten geriet. Sie wurden der Spionage verdächtigt, von den Rebellen gefesselt, geprügelt, mit Stiefeln und Gewehrkolben malträtiert, mit dem Kopf nach unten an einem Baum aufgehängt. Sie warteten auf ihre Exekution, wurden stattdessen an ein Armeelager der sudanesischen Regierung verbracht, erneut geschlagen, vom Militär- an ein Zivilgericht überstellt, nach Khartum geflogen - und schließlich doch, dank amerikanischer Intervention, auf freien Fuß gesetzt.
Seit der Spionage-Anklage lebt Daoud Hari in den USA - als einer von drei Flüchtlingen aus Darfur, denen die Bush-Administration Asyl gewährte. Dort hat er - unterstützt von Lektoren - sein Buch geschrieben, die Erinnerungen an "Leben und Sterben in Darfur", die ihm viel Publicity einbrachten. Er nutzt sie, um aufmerksam zu machen auf einen schrecklichen Konflikt, gegen den Daoud Hari nicht müde wird anzukämpfen. Nicht mit der Waffe, mit dem Wort. Als Übersetzer. Und als Erzähler.
service
Daoud Hari, "Der Übersetzer. Leben und Sterben in Darfur", aus dem Englischen übersetzt von Elsbeth Ranke, Blessing Verlag