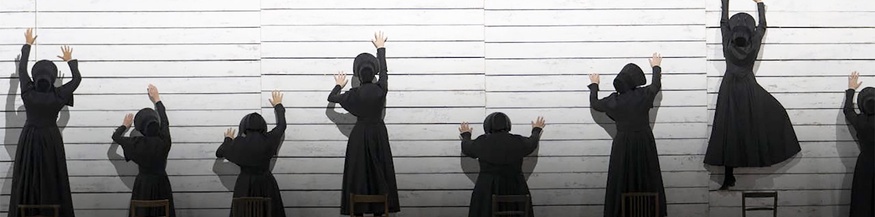Von der Eiszeit zur globalen Erwärmung
Die Kulturgeschichte des Klimas
In Zeiten, in denen Untergangspropheten vor den unwiderruflichen Folgen der globalen Erwärmung warnen, darf der große epochenübergreifende Vergleich nicht fehlen. Wolfgang Behringer schickt uns in seinem Buch auf eine turbulente Reise.
8. April 2017, 21:58
Die Erde existiert seit mehr als fünf Milliarden Jahren, und vieles spricht dafür, dass sie noch einmal so lange Bestand haben wird, egal, was die Menschen auf ihr anstellen. Während ihrer Existenz waren Klimaänderungen die Regel. Die Skala der Veränderungen reicht vom heißen Höllenplaneten bis zur Eiskugel. Während der längsten Zeit ihrer Milliarden Jahre dauernden Existenz war es auf der Erde sehr viel heißer als heute.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Wolfgang Behringer streitet die globale Erwärmung nicht ab und er streitet nicht ab, dass diese Erwärmung zumindest teilweise anthropogen, also vom Menschen verursacht ist. Seine "Kulturgeschichte des Klimas" wendet sich eher gegen eine Vorstellung, die in der aktuellen Debatte mitzuschwingen scheint: die Illusion eines stabilen Klimas.
Klimaveränderungen prägen die Zivilisation
Die Geschichte zeigt: Immer wieder war die Menschheit extremen Wetterbedingungen ausgesetzt - möglicherweise mit ein Grund, warum Gottheiten als personifizierte Wettererscheinungen in den alten Religionen und Mythen eine prominente Stelle einnahmen. Klimaveränderungen haben die Ausformung kultureller Praktiken und die Entwicklung der menschlichen Zivilisation geprägt. Das Ende der Eiszeit und die darauf folgende Klimaerwärmung zum Beispiel schuf erst die Voraussetzungen für das Sesshaftwerden der Menschen in der Jungsteinzeit.
Das Neolithikum steht für eine entscheidende Phase der Menschheit: nämlich für den Übergang von der halbnomadischen Jäger- und Sammlerkultur der Mittelsteinzeit zu einer sesshaften Bauern- und Viehhalterkultur. Der Übergang vom Jägertum zum Ackerbau war von so großer Bedeutung, dass man ihn mit der Industriellen Revolution verglichen hat. Auch wenn man heute die Übergänge fließend sieht, so kann man doch behaupten, dass unter Eiszeitbedingungen keine ähnliche Entwicklung stattgefunden hätte.
Ackerbau und Viehzucht in Grönland
Dass das Klima in der Vergangenheit erheblichen Schwankungen unterlegen ist, zeigt auch die so genannte Mittelalterliche Warmzeit: Die Wikinger sind im 10. und 11. Jahrhundert mit ihren Schiffen bekanntlich über Island bis nach Grönland und von dort bis nach Nordamerika vorgedrungen. Die Schiffspassage von Island nach Grönland war zu jener Zeit fast das ganze Jahr eisfrei.
Von Wikingersiedlungen auf Grönland weiß man, dass Ackerbau und Viehzucht betrieben wurde. Und nicht umsonst wählte der Entdecker Erik der Rote den Namen Grönland, was auf Dänisch so viel wie das "Grünland" bedeutet. Manche Historiker werfen Erik dem Roten zwar Zweckoptimismus, oder schlichtweg Irreführung der Siedler, die er für sein Auswanderungsprojekt begeistern wollte, vor. Klar ist aber, dass die Temperaturen in Grönland zur Zeit der so genannten Mittelalterlichen Warmzeit bedeutend höher waren als heute.
Aus der Geschichte lernen
Wolfgang Behringer will die aktuelle Klimaveränderung mit seinem historischen Rückblick nicht bagatellisieren, aber er plädiert dafür, der Hysterie mancher Klimaforscher mit Skepsis zu begegnen. Zum Beispiel indem er darauf aufmerksam macht, dass bis in die 1960er und 1970er Jahre nicht das Thema Global Warming sondern Global Cooling auf den Fahnen der internationalen Klimaforschung stand.
Man möge aus der Geschichte lernen, scheint der Historiker Behringer zu sagen, und will seinen Leser deshalb wohl auch nicht den Maßnahmenkatalog, der gegen das Global Cooling ersonnen worden ist, vorenthalten.
Zur Debatte stand das Abdecken der Polkappen mit schwarzen Folien oder - aus heutiger Sicht besonders originell - die vermehrte Produktion von CO2 zur Verstärkung des Treibhauseffektes. Und auch die Militärs fühlten sich inspiriert. Sie schlugen vor: die Sprengung unterseeischer Berge südwestlich der Färöer-Inseln mit Hilfe von Atombomben zur Verlängerung warmer Meeresströmungen in die Arktis, die Aufheizung Grönlands mit Hilfe von Atomreaktoren oder das Schmelzen des Poleises mit Wasserstoffbomben. Diese Pläne hören sich an wie aus der Gedankenwelt des Dr. Seltsam. Man hielt sie selbst damals für zu problematisch, um sie in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Aber man hielt sie in Reserve für den Fall, dass sich das Cooling verstärke.
Keine apokalyptischen Visionen
Wolfgang Behringers "Kulturgeschichte des Klimas" will als sachlicher Beitrag zur aktuellen Klimadebatte verstanden werden. Politik und Wissenschaft müssen sich, so Behringer, den Herausforderungen des globalen Klimawandels stellen. Mit den apokalyptischen Visionen mancher Klimapropheten sei der Menschheit aber nicht gedient, denn, so schreibt Wolfgang Behringer:
Die Zukunft ist schwer vorhersehbar. Seriöse Wissenschafter sollten sich hüten, in die Rolle des Nostradamus zu schlüpfen.
Hör-Tipp
Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr
Buch-Tipp
Wolfgang Behringer, "Die Kulturgeschichte des Klimas. Von der Eiszeit zur globalen Erwärmung", C. H. Beck
Link
C. H. Beck - Wolfgang Behringer